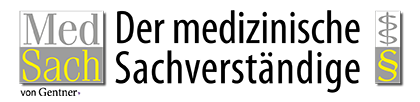Menschen, die sich fast ausschließlich in der virtuellen Welt des Internets bewegen, ziehen sich in vielen Fällen gleichzeitig aus der realen Welt zurück und vereinsamen. Oft leiden sie auch unter psychischen Störungen wie Ängsten oder Depressionen oder einer Substanzabhängigkeit. „Im Rahmen unserer Studie sind wir der Frage nachgegangen, ob Menschen mit einer Internetabhängigkeit ein erhöhtes Risiko für das Auftreten lebensverneinender Gedanken oder Impulse haben“, erläutert der Autor Toni Andreas Steinbüchel von der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der LWL-Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. Im Rahmen einer umfassenden Literaturrecherche identifizierten Steinbüchel und seine Kollegen 15 Studien, die es erlaubten, konkrete Aussagen zu Häufigkeit und Schweregrad begleitender psychischer Störungen zu machen.
Steinbüchel fasst die Ergebnisse dahingehend zusammen, dass die Punktprävalenz* für Suizidalität bei einer Internetabhängigkeit in den außereuropäischen Studien zwischen 21,6 und 47 Prozent lag. In zwei europäischen Studien wurden Punktprävalenzen von 27,5 Prozent beziehungsweise 42,3 Prozent ermittelt. Die Werte in den gesunden Vergleichsgruppen waren mit Punktprävalenzen von 10,9 beziehungsweise 12,7 Prozent niedriger. Nur eine Studie untersuchte die Lebenszeitprävalanz** und lag bei Internetabhängigkeit bei 21,6 Prozent; bei gesunden Probanden bei 14 Prozent. Auch konnte eine Korrelation zwischen Internetabhängigkeit und psychischen Störungen einerseits und selbstverletzenden Handlungen und Suizidalität gefunden werden.
Ob Internetabhängigkeit und Suizidgedanken durch bereits vorbestehende depressive Störungen verstärkt werden oder aber die Psyche erst infolge der Internetabhängigkeit und ihren sozialen Folgen leidet, lässt sich an Hand der aktuellen Studienlage nicht klären. Für die Frage nach Ursache und Wirkung sind Langzeitstudien notwendig. Steinbüchel und Kollegen plädieren für eine differenzierte Betrachtung: „Die erhöhte Suizidalität bei Internetabhängigen allein auf psychische Vorerkrankungen zurückzuführen, greift sicher zu kurz.“ Eine Depression entwickele sich gerade dann, wenn eine Suchterkrankung bereits gravierende Auswirkungen auf den Alltag des Betroffenen habe, wie etwa Verlust des Partners, des Ausbildungs- oder des Arbeitsplatzes. Vieles spreche daher für ein Sowohl-als-auch: Depressivität könne als Risikofaktor die Entstehung einer Internetabhängigkeit fördern, aber auch infolge der Sucht erst entstehen.
Unabhängig von der Ursache-Wirkungs-Beziehung weisen die Autoren der Studie darauf hin, dass suizidale und selbstverletzende Impulse und Verhaltensweisen in der Diagnostik und Therapie von internetabhängigen Patienten in jedem Fall berücksichtigt werden müssten. Insbesondere während des Entzugs sollten Therapeuten sensibel dafür sein. „In dieser Phase fällt die starke Identifikation mit den digitalen Stellvertretern wie Avataren und Accounts plötzlich weg“, erläutert Steinbüchel. Umso stärker würden dann die negativen Folgen der Sucht im Alltag sichtbar.
*Die Punktprävalenz gibt Auskunft über die Anzahl der Fälle eins gesundheitsbezogenen Ereignisses zu einem bestimmten Zeitpunkt.
**Die Lebenszeitprävalenz erfasst die Häufigkeit einer Erkrankung in der bisher verstrichenen Lebenszeit.
T. A. Steinbüchel et al.:
Internetabhängigkeit, Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten – ein systematisches Review
PPmP – Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie 2018; 68 (11); S.451–461
Pressemittelung Thieme Kommunikation