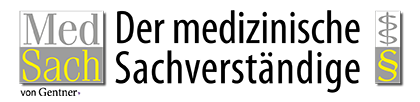Dieses Prozedere widerspreche neuen internationalen Leitlinien zu „Geschlechtsinkongruenz“, die in der neuen ICD-11 voraussichtlich nicht mehr als psychische Erkrankung klassifiziert werde. Gemessen an dem hohen Informationsbedarf gebe es zudem zu wenig Beratungsstellen und zu wenig Experten, die sich mit dem Thema Identitätswechsel und Therapie auskennen.
Wenn sich ein Mann oder eine Frau in seinem oder ihrem Körper nicht “zuhause” fühlt und die körperlichen Merkmale nicht mit der empfundenen Geschlechtszugehörigkeit übereinstimmen, können häufig psychische Belastungen entstehen. „Das Gefühl, nicht zu dem eigenen anatomischen Geschlecht zu passen, führt zu Unbehagen: Experten sprechen von Geschlechtsinkongruenz. Die Betroffenen haben häufiger als andere Depressionen, Suizidgedanken, Angststörungen oder Probleme mit Suchtmitteln“, berichtete Sven Diederich, Ärztlicher Leiter von Medicover Deutschland aus Berlin. „Ursache dafür sind meist nicht etwa psychische Störungen, sondern die Diskriminierung der Gesellschaft und die Hürden im Gesundheitswesen“, so der Vizepräsident der DGE.
Geschlechtsidentität ist die von jedem Menschen individuell empfundene Geschlechtszugehörigkeit. Stimmt diese nicht mit den körperlichen Merkmalen überein, kann mit einer Hormonbehandlung und Operationen in das andere gewünschte Geschlecht „gewechselt“ werden. Das ist kein einfacher Vorgang, sondern ein komplexer monatelanger Prozess, der viel Wissen und Erfahrung aufseiten der Behandelnden voraussetzt und der/dem Betroffenen körperlich und psychisch viel abverlangt.
Bei der „Alltagserprobung“ über mindestens zwölf Monate soll die/der Betroffene über den gesamten Zeitraum und in allen Bereichen ihres/seines Lebens in dem gewünschten Geschlecht leben, um die „neue“ Geschlechterrolle zu erproben, so verlangen es die Kassen. „Das widerspricht allen neuen internationalen Leitlinien und muss geändert werden“, forderte Diederich.
Dass es mit einem vereinfachten Begutachtungsverfahren nicht getan ist, ergänzte Matthias Weber, Mediensprecher der DGE: „Es gibt noch immer sehr viele Vorurteile in der Bevölkerung gegenüber Transgender-Menschen. Wir brauchen mehr Aufklärung in der Gesellschaft, aber auch mehr Beratungsstellen für die Betroffenen.“ Auch die Kompetenzen der behandelnden Ärzte müssten ausgebaut werden.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden
Wenn sich ein Mann oder eine Frau in seinem oder ihrem Körper nicht “zuhause” fühlt und die körperlichen Merkmale nicht mit der empfundenen Geschlechtszugehörigkeit übereinstimmen, können häufig psychische Belastungen entstehen. „Das Gefühl, nicht zu dem eigenen anatomischen Geschlecht zu passen, führt zu Unbehagen: Experten sprechen von Geschlechtsinkongruenz. Die Betroffenen haben häufiger als andere Depressionen, Suizidgedanken, Angststörungen oder Probleme mit Suchtmitteln“, berichtete Sven Diederich, Ärztlicher Leiter von Medicover Deutschland aus Berlin. „Ursache dafür sind meist nicht etwa psychische Störungen, sondern die Diskriminierung der Gesellschaft und die Hürden im Gesundheitswesen“, so der Vizepräsident der DGE.
Geschlechtsidentität ist die von jedem Menschen individuell empfundene Geschlechtszugehörigkeit. Stimmt diese nicht mit den körperlichen Merkmalen überein, kann mit einer Hormonbehandlung und Operationen in das andere gewünschte Geschlecht „gewechselt“ werden. Das ist kein einfacher Vorgang, sondern ein komplexer monatelanger Prozess, der viel Wissen und Erfahrung aufseiten der Behandelnden voraussetzt und der/dem Betroffenen körperlich und psychisch viel abverlangt.
Bei der „Alltagserprobung“ über mindestens zwölf Monate soll die/der Betroffene über den gesamten Zeitraum und in allen Bereichen ihres/seines Lebens in dem gewünschten Geschlecht leben, um die „neue“ Geschlechterrolle zu erproben, so verlangen es die Kassen. „Das widerspricht allen neuen internationalen Leitlinien und muss geändert werden“, forderte Diederich.
Dass es mit einem vereinfachten Begutachtungsverfahren nicht getan ist, ergänzte Matthias Weber, Mediensprecher der DGE: „Es gibt noch immer sehr viele Vorurteile in der Bevölkerung gegenüber Transgender-Menschen. Wir brauchen mehr Aufklärung in der Gesellschaft, aber auch mehr Beratungsstellen für die Betroffenen.“ Auch die Kompetenzen der behandelnden Ärzte müssten ausgebaut werden.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden