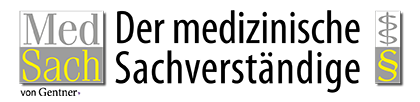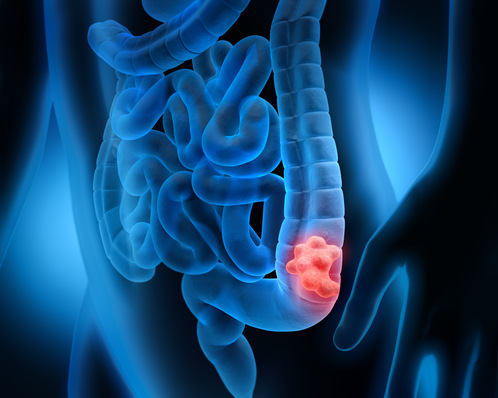Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) findet auch dann Anwendung, wenn der Behandlungsvertrag mit einer juristischen Person, zum Beispiel einem Krankenhausträger, abgeschlossen wird und ambulante Leistungen durch Ärzte erbracht werden, die lediglich im Rahmen eines Anstellungs- oder Beamtenverhältnisses in der Erfüllung ihrer eigenen Dienstaufgaben tätig werden und selbst mit dem Patienten keine Vertragsbeziehung eingehen, erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) mit Grundsatzurteil vom 4.4.2024 (AZ: III ZR 38/23 - OLG Köln) und entschied damit eine bisher in der Literatur umstrittene Frage.
Strittig war die Abrechnung der ambulanten Behandlung eines Prostatakarzinoms mit dem innovativen Cyberknife-Verfahren an einem Universitätsklinikum. Das Verfahren ist in dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) für gesetzlich krankenversicherte Patienten nicht enthalten und gehört daher grundsätzlich nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen.
Zwischen der beklagten Klinik und dem Verband der Privaten Krankenversicherung beziehungsweise einzelnen Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen zwar Vereinbarungen zur Vergütung des Cyberknife-Verfahrens, denen jedoch die (gesetztliche) Krankenkasse, bei welcher der Kläger versichert war, nicht beigetreten war, da sie das Verfahren als „unkonventionelle Methode“ einstufte. Die „Cyberknife Komplexleistung III“ wurde vom Universitätsklinikum mit einem Pauschalbetrag von 10.633 € berechnet.
Eine solche pauschale Abrechnung ist jedoch nicht zulässig, erklärte der BGH: Entgegen der Auffassung der Klinik unterfallen die im vorliegenden Fall im Rahmen der Cyberknife-Behandlung erbrachten ambulanten ärztlichen Leistungen den Vorschriften der Gebührenordnung für Ärzte. Deren in § 1 Abs. 1 GOÄ beschriebener Anwendungsbereich setzt nicht voraus, dass Anspruchsteller und Vertragspartner des Patienten ein Arzt ist, sondern dass die Vergütung für die beruflichen Leistungen eines Arztes geltend gemacht wird.
Denn § 1 Abs. 1 GOÄ und ähnlich § 11 Satz 1 der Bundesärzteordnung (BÄO) beziehen sich explizit auf „Vergütungen für die beruflichen Leistungen der Ärzte“ beziehungsweise – inhaltlich gleichbedeutend – auf „Entgelte für ärztliche Tätigkeit“ und nicht auf die Regelung von Forderungen der Ärzte (für ihre ärztliche Tätigkeit). Dafür, dass von der Verordnungsermächtigung nur diejenigen Fälle erfasst werden sollten, in denen die tätig werdenden Ärzte die von ihnen erbrachten Leistungen auch selbst in Rechnung stellen, gibt der Wortlaut nichts her, stellte der BGH klar:
Allein dieses weite Verständnis des Anwendungsbereichs der GOÄ wird deren Sinn und Zweck gerecht, der darin besteht, einen angemessenen Interessenausgleich herbeizuführen zwischen denjenigen, die die Leistung erbringen, und denjenigen, die zu ihrer Vergütung verpflichtet sind. Dies ist unabhängig davon, ob der Arzt oder ein Dritter (eine juristische Person) Vertragspartner des Patienten geworden ist.
Die GOÄ verfolgt als öffentlich-rechtliches Preisrecht einerseits das Ziel, für die Leistungserbringer auf Grund angemessener Einnahmen die zuverlässige Grundlage für die Erbringung sorgfältiger hochwertiger ärztlicher Leistungen zu sichern, und bezweckt andererseits, eine unkontrollierbare und unzumutbare finanzielle Belastung der zahlungspflichtigen Patienten und der gegebenenfalls dahinter stehenden Kostenträger (private Krankenversicherer, Beihilfe) zu verhindern. Auf diese Weise soll ein Ausgleich zwischen den gegenläufigen Interessen von Patienten und Ärzten dahingehend herbeigeführt werden, weder ein zu hohes Entgelt entrichten zu müssen noch nur ein zu geringes Entgelt fordern zu dürfen.
Vor diesem Hintergrund wäre es nicht nachvollziehbar, die Interessen der zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten (der Patienten) als weniger schutzbedürftig und die Interessen der an den Entgelten Berechtigten (hier der Klinik) als weniger regelungsbedürftig anzusehen, wenn die ärztliche Tätigkeit durch einen Arzt erbracht wird, der von einer juristischen Person beschäftigt wird, mit welcher der Patient einen Behandlungsvertrag abschließt.
Die der Rechnung des Universitätsklinikums zugrundeliegende Vereinbarung eines Pauschalhonorars von 10.633 € für die Cyberknife-Behandlung entspricht nicht den Vorgaben von § 2 Abs. 1, 2 GOÄ und ist deshalb gemäß § 125 Satz 1 BGB beziehungsweise § 134 BGB nichtig, so der BGH, denn die GOÄ ist nicht zugunsten eines Pauschalhonorars abdingbar.
Die beklagte Klinik kann die Vereinbarung eines Pauschalhonorars auch nicht mit dem Einwand rechtfertigen, dass die Cyberknife-Bestrahlung bislang im Gebührenverzeichnis zur GOÄ nicht aufgeführt ist. Gemäß § 6 Abs. 2 GOÄ können nämlich selbständige Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden (z. B. Abschnitt O: Strahlendiagnostik, Nuklearmedizin, Magnetresonanztomographie und Strahlentherapie).
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden