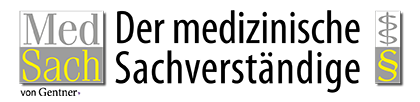Erste wissenschaftliche Kriterien zur diagnostischen Einordnung des psychiatrischen Krankheitsbildes Gaming Disorder wurden bereits 2013 im US-amerikanischen Raum erarbeitet. 2019 folgte ein europäischer Diagnosekatalog. Dabei wird in beiden Fällen ein intensiver Gebrauch digitaler Spiele mit bestimmten psychiatrischen Folgeerscheinungen in Verbindung gesetzt. Dazu zählt beispielsweise ein zunehmender Kontrollverlust. Das heißt, die Betroffenen können ihren Spielkonsum immer weniger steuern oder stoppen. Auch spielen sie, trotz negativer Konsequenzen in sozialen oder beruflichen Bereichen, weiter. „Im Zusammenhang mit exzessivem Konsum digitaler Spiele werden Schlafstörungen, aber auch Reizbarkeit, Aggression, Depression und eine Reihe von sozialen, beruflichen und schulischen Problemen beobachtet“, berichten Mikusky und Abler in ihrem Artikel. Beide arbeiten an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III des Universitätsklinikums Ulm. Patienten mit einer Gaming Disorder weisen auch Symptome auf, die analog bei stoffgebundenen Süchten, wie etwa der Alkoholsucht, zu beobachten sind. Hierzu zählen etwa Entzugserscheinungen oder der Verlust anderer Interessen. Erkenntnisse aus der neurobiologischen Forschung weisen zudem auf eine gestörte Impulskontrolle bei den betroffenen Patienten hin.
Aufgrund dieser negativen Auswirkungen des eigenen Nutzungsverhaltens suchen immer mehr Betroffene Beratungsangebote auf. Während sich die Spielindustrie über die wachsenden Nutzerzahlen freut, deuten erste wissenschaftliche Untersuchungen daraufhin, dass gerade bei Jugendlichen das Spielen außer Kontrolle geraten kann. So spielten allein in Deutschland im Jahr 2019 über 5,6 Millionen Jugendliche regelmäßig Videospiele. Dies ergab eine Erhebung, die von der deutschen Gamesbranche in Auftrag gegeben wurde. Gleichzeitig weisen erste repräsentative Studien zur Gaming Disorder auf eine zunehmende gesellschaftliche Relevanz des psychiatrischen Krankheitsbildes hin. So zeigte eine Untersuchung in sieben europäischen Ländern, dass 1,6 Prozent der befragten Jugendlichen deutliche Anzeichen einer Abhängigkeit von Videospielen aufwiesen.
Vor allem die komplexen Spielmechaniken und die ausgeklügelten Bezahlmodelle moderner Videospiele sind nach Ansicht der Autoren bedenklich. „Die Entwickler implementieren bewusst eine Vielzahl visueller und akustischer Hinweisreize, welche Erfolge und Spielfortschritte spürbar machen“, erklären Mikusky und Abler. Diese Spielabläufe können eine Suchtentstehung begünstigen, da die wahrgenommenen Signale an positive Emotionen gekoppelt werden.
Zudem animieren bestimmte Bezahlmodelle impulsanfällige Spielerinnen und Spieler zu spontanen Kaufentscheidungen. Mikrotransaktionen ermöglichen ihnen etwa einen schnelleren Spielfortschritt, Vorteile in Multiplayer-Spielen oder kosmetische Anpassungen des Spielcharakters durch kleine Geldbeträge zu erwerben. Dadurch könne das Suchtverhalten wiederum befördert werden, so die Autoren. Auch sogenannte Lootboxen können per Mikrotransaktion erstanden werden. Hier erwerben Nutzerinnen und Nutzer zufällig zusammengestellte spielrelevante Belohnungen. Sie sind besonders riskant für Suchtgefährdete und verleiten sie oft dazu, in Summe hohe Geldbeträge zu investieren. Damit sind Lootboxen mit klassischen Glückspielautomaten vergleichbar, fallen jedoch nicht unter die Glücksspielgesetzgebung. Hier besteht also Handlungsbedarf von Seiten des Gesetzgebers. Im kürzlich überarbeiteten Jugendschutzgesetz wird der Gefährdung erstmals Rechnung getragen: Elemente wie Lootboxen müssen bei der Altersfreigabe von Spielen zukünftig berücksichtigt werden.
D. Mikusky und B. Abler:
Wann machen digitale Spiele krank?
Nervenheilkunde 2021; 40 (1/2); S.27–34
Pressemitteilung Thieme Gruppe