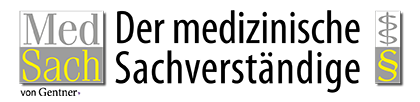Die Behandlung mit kornealem Crosslinking erfolgt bei progredienter Veränderung tendenziell bei jüngeren Patienten mit einer ausreichend guten Sehschärfe (von zumindest 0,5). Die laut dem Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) erforderlichen Kriterien für die Durchführung des kornealen Crosslinkings sind die Diagnosestellung Keratokonus, die subjektive Sehverschlechterung und eine Progredienz innerhalb der letzten 12 Monate.
Zudem sollte mindestens eines der folgenden drei Kriterien erfüllt sein:
· Eine Zunahme der maximalen Hornhautbrechkraft um mehr als 1 Dioptrie
· Eine Zunahme der subjektiven Refraktion und des Astigmatismus um mehr als 1 Dioptrie
· Eine Abnahme der Basiskurve der bestsitzenden Kontaktlinse um mehr als 0,1 mm
Die zentrale Hornhautdicke in der Pachymetrie sollte 450 μm (ohne Epithel 400 μm) nicht unterschreiten.
Das korneale Crosslinking folgt dem Prinzip einer Freisetzung von reaktivem Sauerstoffradikalen nach Vorbehandlung mit einem Photosensitizer und anschließender UV-Bestrahlung. Dies führt zu einer verstärkten Quervernetzung des Kollagenfibrin und damit zu einer Stabilisierung der Hornhaut.
Es handelt sich um eine ziemlich sichere und effiziente Behandlung, die den kornealen Keratokonus stabilisiert; sie verzögert und verhindert damit Transplantation. Insgesamt ist deshalb die Zahl der perforierenden Keratoplastik für den Keratokonus in letzten 10 Jahren dramatisch zurückgegangen. Die korneale Crosslinking-Behandlung ist zudem auch sehr langzeitstabil; nur 1 % bis 5 % der Patienten benötigen eine Nachbehandlung.
Indikation zur kornealen Crosslinking-Behandlung sind also die dokumentierte Diagnose Keratokonus, eine dokumentierte Progression, eine ausreichend gute, mit Kontaktlinse oder Brille erreichbare Sehschärfe von ≥ 0,5 und eine ausreichende zentrale Hornhautdicke, fasste Cursiefen zusammen.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden