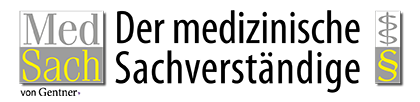Die Perfektionierung und Verfeinerung der Beweislastumkehr durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Arzthaftungsrecht ist inzwischen wohl fast abgeschlossen, berichtete Tanja Unger von der Kanzlei für Medizinrecht Putz-Sessel-Steldinger in München auf dem 15. Gynäkologische-Onkologie-Update-Seminar am 1. und 2. Oktober 2021 (Livestream-Veranstaltung). Sie erläuterte die Problematik des Befunderhebungsfehlers:
Es ist für den Patienten ganz besonders ärgerlich, wenn entscheidende und damit gebotene Befunde nicht erhoben worden sind. Dies kann zur falschen Diagnose und zur falschen Weiterbehandlung führen. Der Patient indes hat Beweisschwierigkeiten, weil nicht feststeht, welcher Befund sich ergeben und wie er sich ausgewirkt hätte auf Diagnose, Behandlung und Ursachenzusammenhang.
Hier hat die Rechtsprechung mit einer Differenzierung der Beweislast einen fairen Ausgleich geschaffen, kommentierte Unger: Die unterlassene Befunderhebung muss nur ein einfacher (nicht einmal ein grober) Behandlungsfehler sein. Weiter fordert die Rechtsprechung, dass die gebotene aber unterlassene Befunderhebung (hypothetisch) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (> 50 %) einen reaktionspflichtigen Befund erbracht hätte (Beweis durch das gerichtliche Sachverständigengutachten).
Ist dies der Fall, fragt die Rechtsprechung – weiter hypothetisch – den Sachverständigen, ob die Untätigkeit nach einem solchen hypothetisch reaktionspflichtigen Befund fachärztlich nachvollziehbar wäre. Wertet nun der Sachverständige das hypothetische Untätigbleiben nach einem hypothetisch überwiegend wahrscheinlichen Befund als schlechterdings fachärztlich nicht nachvollziehbar, so wäre dies ein grober Behandlungsfehler. Dann braucht der Patient nur noch zu beweisen (wieder durch Sachverständigengutachten), dass ihm die hypothetisch gebotene, aber unterlassene Behandlung wenigstens eine realistische Chance eines besseren Outcomes oder einer Restitutio ad Integrum gebracht hätte.
Für die Bejahung einer realistischen Chance genügt, dass der positive Verlauf nicht gänzlich unwahrscheinlich ist (sog. Schadenseignung). Eine mögliche Prognoseverschlechterung wie beispielsweise bei einem aufgrund unterlassener Befunderhebung zu spät entdeckten und behandelten Ovarialkarzinom genügt hier mithin.
Im Ergebnis führt also selbst der einfache Befunderhebungsfehler zu einer Beweislastumkehr wie nach einem groben Behandlungsfehler. Das erscheint hart, gleicht aber aus, dass aus Gründen in der Sphäre des Arztes der Patient mit Wahrscheinlichkeit geschädigt wurde und eben diese Umstände ihm auch noch den Strengbeweis vereiteln, erklärte Unger.
Es tröste den betroffenen Arzt vermutlich wenig, wenn der Bundesgerichtshof (BGH) betone, dass darin keine Sanktion zu sehen sei. Die emotionale Ablehnung dieser Rechtsprechung durch die Ärzteschaft zeige sich auch immer wieder bei den gerichtlichen Sachverständigen: Häufig könne ihnen die Komplexität dieser Rechtsprechung erst bei ihrer Anhörung vor Gericht vermittelt werden. Ein Sachverständiger könne sich also unter Umständen die Anhörung vor einem Zivilgericht ersparen, wenn er sich frühzeitig mit dieser Rechtsprechung vertraut mache.
Für den Geschädigten führt der Vorwurf der Nichterhebung gebotener Befunde deutlich eher zum Ziel als der Vorwurf, der Arzt habe die erhobenen Befunde falsch bewertet, denn für den Vorwurf der Fehldiagnose setzt die Rechtsprechung dem Patienten deutlich höhere Hürden. Das Finden der korrekten Diagnose lässt sich auch als die „Königsdisziplin“ der ärztlichen Tätigkeit beschreiben, bei der sich die Rechtsprechung mit Vorwürfen zurückhält. Der auf Patientenseite tätige Arzthaftungsrechtler „sucht“ also den Befunderhebungsfehler, während dagegen der Anwalt des Arztes versucht, einen Diagnoseirrtum oder maximal einen einfachen Diagnosefehler herbei zu argumentieren, so Unger.
Auch wenn die Abgrenzung im Einzelfall nicht immer einfach ist, hat die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hier klare Kriterien definiert: Demnach liegt ein Befunderhebungsfehler dann vor, wenn die Erhebung medizinisch gebotener Befunde unterlassen wird, während ein Diagnosefehler die verfehlte Interpretation von Befunden ist, weswegen die gebotenen weiteren diagnostischen oder auch therapeutischen Maßnahmen unterbleiben.
Fall: Befunderhebungsfehler bei Zusammenarbeit von Gynäkologen und Radiologen in der Diagnostik eines Mammakarzinoms:
Unger schilderte einen Fall aus ihrer Kanzlei, in welchem eine Schlichtungsstelle – aufbauend auf dieser Rechtsprechung – 2020 folgende Bewertung getroffen hat: Einem Facharzt für Radiologie wie auch einem Facharzt für Gynäkologie, der Brustdiagnostik durchführt, müssen die Limitationen der diagnostischen Methoden und die Abklärungsalgorithmen der gültigen S3-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms vertraut sein. Werden Befunde von zwei unterschiedlichen Fachärzten erhoben, sind eine Zusammenführung der Befunde und deren Einordnung erforderlich. Dies ist Aufgabe des primär betreuenden Gynäkologen, der die initialen Befunde erhoben und die Zusatzdiagnostik in einem anderen Fachgebiet veranlasst hat.
Ist bei einem sonographisch durch den Gynäkologen festgestellten suspekten Mammabefund und zugleich sehr hoher Brustgewebsdichte die vom Radiologen durchgeführte Mammographie per se nicht suspekt, ist dennoch zwingend zeitnah eine ergänzende histopathologische Abklärung durchzuführen, um sicher eine Malignität auszuschließen. Die Empfehlung einer weiteren Kontrolle in 6 Monaten ist hier seitens des Gynäkologen nicht ausreichend. Bei einer sich wegen dieses Unterlassens aus der mehrere Monate verzögerten onkologischen Behandlung eines doch vorliegenden Mammakarzinoms ergebenden Prognoseverschlechterung handelt es sich um einen zum Schadensersatz verpflichtenden Umstand.
Und wenn ein Befund verloren gegangen ist?
Sehr ärgerlich ist es für den Arzt, wenn der erforderliche Befund zwar erhoben worden war, aber (unverschuldet) verloren gegangen ist. Auch hier verweist der Bundesgerichtshof darauf, dass die Verteilung der Beweislast Billigkeitsgründen entspricht und keine Sanktion gegen den Arzt darstellt, weshalb es auch nicht darauf ankommt, ob der Verlust von Dokumenten verschuldet ist oder nicht, erklärte Unger:
Verschwundene Bildgebung (z. B. Röntgen, CT oder MRT) oder ein unauffindbares Kardiotokogramm (simultane Registrierung und Aufzeichnung der Herzschlagfrequenz des ungeborenen Kindes und der Wehentätigkeit bei der werdenden Mutter) haben daher zu der Rechtsprechung geführt, dass es zur gleichen Beweislastumkehr wie bei Nichterhebung des Befundes kommt. Die Rechtsprechung hat dies wiederum zum Ausgleich dafür entwickelt, dass durch das Fehlen eines Befundes, wie beim groben Fehler, das Spektrum der für die Schädigung des Patienten in Betracht kommenden Ursachen besonders verbreitert oder verschoben worden ist, ohne jedoch hierin einen Vorwurf gegen den Arzt zu begründen.
Ein Befund oder eine indizierte Bildgebung, die nicht in der Akte sind, werden vom Gericht somit als nicht erhoben betrachtet, warnte Unger.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden