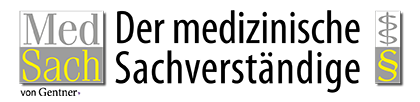Ist ein positiver Therapieverlauf nicht auf eine nachweisbar wirksame Komponente, wie etwa die Wirkstoffe eines Medikaments, sondern auf Kontextfaktoren zurückzuführen, spricht man von einem Placebo-Effekt. „Dieser wurde lange Zeit ignoriert und eher als unerwünschte Nebenwirkung betrachtet. Heute weiß man, dass Placebo-Effekte die Wirksamkeit einer Behandlung unterstützen“, erklärt PhD Geert Rutten, der an der HAN University of Applied Science in Arnheim/Niederlande und der Universität Maastricht forscht und unterrichtet. Auch die Ansprache des Therapeuten kann mitentscheidend für den Therapieverlauf sein – also im positiven Sinn einen Placebo-Effekt, umgekehrt aber auch einen Nocebo-Effekt haben.
Beispielsweise hängt die Wirksamkeit eines Übungsprogramms nicht nur von der genauen Form und dem Inhalt der Übungen selbst ab, sondern auch von einer guten Anleitung. Grundsätzlich gehe es darum, eine positive Erwartungshaltung bei den Patienten zu wecken und antizipierte Ängste, zum Beispiel vor möglichen Schmerzen, zu reduzieren. Dessen sollten sich Therapeuten bewusst sein. Denn negative Erwartungen können sich direkt auf das Schmerzempfinden auswirken, wenn sie antizipierte Ängste verstärken. Das belegt auch eine von Geert Rutten zitierte Studie: Bei gesunden Probanden wurde mittels Elektrostimulation künstlich ein Schmerzreiz gesetzt. Danach erhielten sie ein Schein-Medikament verbunden mit der Aussage, dass sich der Schmerz dadurch verstärken würde. Tatsächlich berichteten die Teilnehmer danach von einer Zunahme der Schmerzen.
„Um einen Nocebo-Effekt zu reduzieren, sollte unsere Kommunikation dem Patienten ein Gefühl von Sicherheit vermitteln“, ist Geert Rutten überzeugt. Dazu gehöre die Anwendung eines positiven Valenz-Framings. Äußerungen wie „Zu 60 Prozent tritt diese Nebenwirkung nicht ein“ sollten solche wie „Zu 40 Prozent tritt diese Nebenwirkung ein“ vorgezogen werden. Müssen negative Sachverhalte dargelegt werden, ist es empfehlenswert, diese indirekt zu formulieren. So kann die Aussage „Das ist schlecht für Sie“ mehr Ängste beim Gegenüber auslösen als die Formulierung „Das ist nicht gut für Sie“. Des Weiteren sieht Rutten sogenannte „Furchtappelle“ kritisch. Damit sind Äußerungen gemeint, die bewusst negative emotionale Reaktionen hervorrufen sollen, um eine vom Behandler gewünschte Verhaltensänderung herbeizuführen. Rutten erklärt das an einem Beispiel aus der Praxis: Ein Therapeut droht einem Patienten, der unter Rückenschmerzen leidet, mit einem möglichen Bandscheibenvorfall, sollte dieser seinen Ratschlägen nicht Folge leisten. Nach Ansicht des Experten könnten derartige Aussagen bei den Betroffenen unter Umständen eine Selbstverteidigungshaltung auslösen. Das führt letztlich dazu, dass sie an ihrem bisherigen Verhalten eher festhalten, anstatt es zu verändern.
„Eine gute Patienten-Therapeuten-Beziehung zeichnet sich durch Empathie, Vertrauen und Herzlichkeit aus und versucht ganz bewusst, negative Erwartungen und damit verbundene Provokation von Ängsten zu vermeiden“, erklärt Rutten abschließend. Dabei dürfe man den Patienten aber nie täuschen.
G. Rutten:
Die Macht der Worte
Physiopraxis 2019; 17 (11/12); S. 26–29
Pressemitteilung Thieme Gruppe