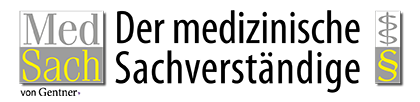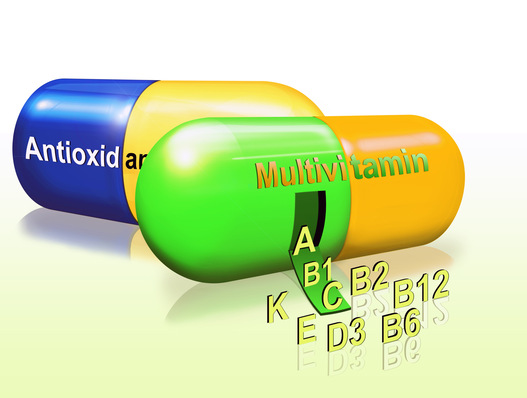Das gerade in Deutschland verbreitete Konzept der stationären psychotherapeutischen Behandlung mit Manual-basierten störungsspezifischen Behandlungsprogrammen erweist sich zunehmend als problematisch, erklärte Martin Bohus, Wissenschaftlicher Direktor am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI), Institut für Psychiatrische und Psychosomatische Psychotherapie in Mannheim, auf dem 10. Psychiatrie-Update-Seminar am 6. und 7. März 2020 in Wiesbaden.
Insbesondere in Deutschland und der Schweiz nutzt man die exklusiven Möglichkeiten von längeren stationären oder teilstationären Behandlungen in psychiatrisch-psychosomatischen Kliniken. Man konzipierte sog. elektive störungsspezifische stationäre Behandlungseinheiten, auf der homogene Patientengruppen von multiprofessionellen Teams nach Manual-basierten störungsspezifischen Behandlungsprogrammen behandelt werden, die rasch einen sehr hohen Erfahrungsstand erreichen. Hohe interne Konsistenz der Behandlungsangebote, klare Strukturen, definierte Abläufe und explizite, transparente Entscheidungsalgorithmen sorgen für gute Teamkohäsion und Expertise.
Die Attraktivität und Effektivität dieser homogenen, störungsspezifischen stationären Behandlungseinheiten für Betroffene, Behandelnde und Planer ermisst sich auch an deren flächendeckender Verbreitung: So entstanden in den letzten zehn Jahren in Deutschland und der Schweiz beispielsweise 63 stationäre Behandlungseinheiten für Patienten mit Borderline-Störungen, die nach den Kriterien der Dialektisch Behavioralen Therapie (DBT) arbeiten und sich einer gemeinsamen Qualitätskontrolle unterziehen (www.dachverbanddbt.de). Auch im Bereich der Essstörungen, Zwangserkrankungen und der chronischen Depressionen hat sich dieses Konzept bewährt – die meisten psychiatrischen Kliniken verfügen heute über eine oder zwei „Vorzeigestationen“, die manualisiert mit homogenen Patienten-Populationen arbeiten.
Das klingt zunächst nach einer Erfolgsgeschichte. Und dennoch stößt dieses Konzept bereits an seine Grenzen und wirft mittlerweile Probleme auf, die direkt das Selbstverständnis der psychiatrischen Behandlung betreffen, warnte Bohus:
Das liegt zum Ersten an den spezifischen Patientenprofilen in psychiatrischen Kliniken, zum Zweiten an den strukturellen Gegebenheiten der stationären und teilstationären psychiatrischen Versorgung und zum Dritten an der inhaltlichen und methodischen Ausrichtung an psychologischer Psychotherapie, welche die psychiatrisch therapeutische Arbeit defizitär und minderwertig erscheinen lässt.
So veröffentlichte die Arbeitsgruppe um M. Franz (Gießen, Marburg) einen konsekutiv erhobenen vollständigen Datensatz von 20.000 Patienten, die im Jahr 2017 in neun psychiatrischen Kliniken in Hessen behandelt worden waren [1]. In einem methodisch aufwendigen Verfahren entwickelte diese Arbeitsgruppe eine Klassifikation sog. „störungsbezogener, behandlungsorientierter Fallgruppen“. Dabei zeigte sich, dass die Behandlung von multimorbiden, häufig auch somatisch erkrankten Patientengruppen mit akuten depressiven Erkrankungen, Alkohol- und Drogenabhängigkeit sowie Psychosen im Zentrum steht. Monosymptomatische Störungen aus dem Spektrum der Angst- oder Zwangsstörungen fanden sich dagegen kaum und auch monosymptomatische Trauma-assoziierte Störungen waren selten.
Die meisten evidenzbasierten Manual-basierten Behandlungsprogramme, die ja für monosymptomatische homogene Störungsbilder konzipiert wurden, greifen hier jedoch zu kurz, kommentierte Bohus diese Ergebnisse.
Auch wenn die Effektivität der störungsspezifischen Behandlungseinheiten zumindest teilweise empirisch nachgewiesen ist, so findet sich jedoch keine einzige Studie, die nachweist, dass das stationäre Behandlungssetting dem Äquivalent der ambulanten Behandlung – trotz deutlich höherer Kosten – überlegen wäre. Dies trifft selbst für schwer gestörte Patienten mit Borderline-Störungen zu [2].
Etwas pointiert ausgedrückt, könnte man durchaus behaupten, dass elektive homogene störungsspezifische Psychotherapiestationen ihre Berechtigung in erster Linie daraus ziehen, dass diese Behandlungsangebote im ambulanten Setting nur unzureichend vorgehalten werden, so Bohus. Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig und komplex und liegen unter anderem in Problemen der schulenbasierten Psychotherapeutenausbildung und der ungleichen lokalen Verteilung von Psychotherapeuten begründet [3].
Probleme zeigen sich zudem im Sektor der Post-Krisen-Behandlung, d. h. nach Abklingen einer krisenhaft zugespitzten psychischen Erkrankung, welche ursprünglich zur stationären Aufnahme geführt hat. Da (definitionsgemäß) psychiatrische Krisen zeitlich limitiert sind, befinden sich die meisten stationär behandelten Patienten im sog. Post-Krisen-Status: Also nicht mehr im lebensbedrohlichen Zustand, aber „noch nicht so weit“, wieder entlassen zu werden.
Je nach Störungsbild, individueller Psychopathologie, sozialen Gegebenheiten und therapeutischen Präferenzen der Behandler reichen die Interventionen in diesem Behandlungssegment von „Stabilisierung“ (klingt deutlich professioneller als Erholung, meint aber meist dasselbe, so Bohus) über Entlassungsplanung, Psychoedukation, Rückfallprophylaxe, bis hin zum „Antherapieren“, das heißt, die Patienten sollen die Erfahrung machen, dass eine psychotherapeutische Behandlung im ambulanten Setting eine wirksame und angenehme Sache wäre, um sich dann auf dem freien ambulanten Markt einen entsprechenden Behandler zu suchen.
Wenn man versucht, die therapeutischen Anforderungen im Post-Krisen-Segment zu operationalisieren, so erfordert jede Behandlungsplanung eigentlich immer eine klare Problem- und Bedingungsanalyse derjenigen Faktoren, die gegenwärtig verhindern, dass der Patient eine adäquate, wirksame ambulante Behandlung bekommt.
Jeder Behandler sollte in der Post-Krisen-Behandlung somit zwei einfache Fragen beantworten können, forderte Bohus:
Kommentar aus gutachtlicher Sicht
Die hier angesprochene Problematik ist auch für den ärztlichen oder psychotherapeutischen Gutachter relevant, der – in der Regel im Auftrag der Krankenversicherung – dazu Stellung nehmen soll, ob eine entsprechende psychotherapeutisch Behandlung in einer psychiatrisch-psychosomatischen Klinik hinsichtlich der Indikation für eine stationäre Aufnahme bzw. der Dauer der (erst noch geplanten bzw. der bereits abgeschlossenen) stationären Behandlung als medizinisch notwendig anzusehen ist.
Literatur
1 Franz, M., Gary, A., Jung, D., Wolff, J.: Störungsbezogene Fallgruppen für eine bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Der Nervenarzt (2020) doi.org/10.1007/s00115-019-00853-4
2 Dinnaeve, R., van den Bosch, W., Hakkaart van Roijen, LMC, Vansteeland, K: Effectiveness of step-down versus outpatient dialectical behaviour therapy for patients with severe levels of borderline personality disorder: A pragmatic randomizes controlled trial. Borderline Persoanlity Disorder and Emotion Dysregulation (2018) vol. 5 p12
3 Bohus, M: Elfenbeintürme im Treibsand. Oder: Was macht es so schwierig, Forschungsergebnisse in der psychotherapeutischen Praxis umzusetzen? Verhaltenstherapie; (2015) 25: 145-155
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden