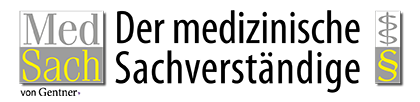Die Frage, welche Maßnahmen der Arzt aus der berufsfachlichen Sicht seines Fachbereichs unter Berücksichtigung der in seinem Fachbereich vorausgesetzten Kenntnisse und Fähigkeiten in der jeweiligen Behandlungssituation ergreifen muss, richtet sich in erster Linie nach medizinischen Maßstäben, die der Tatrichter mit Hilfe eines Sachverständigen zu ermittelt hat, erklärte der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 24.2.2015 (AZ: VI ZR 106/13, OLG Koblenz), über welches die Fachzeitschriften „Versicherungsrecht“ und „Juristen Zeitung“ berichten.
So darf der Tatrichter den medizinischen Standard grundsätzlich nicht ohne eine entsprechende Grundlage in einem Sachverständigengutachten oder gar entgegen den Ausführungen des Sachverständigen aus eigener Beurteilung heraus festlegen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Tatrichter ausnahmsweise selbst über das erforderliche medizinische Fachwissen verfügt und dies in seiner Entscheidung darlegt.
Der BGH rügte damit das vorangegangene Urteil des Oberlandesgerichts (OLG). Dieses hatte eine von der Beurteilung des gerichtlich bestellten Sachverständigen abweichende, eigene medizinische Bewertung des zu beurteilenden Behandlungsgeschehens vorgenommen ohne aufzuzeigen, dass es über die erforderliche Sachkunde verfügt. Damit hat es aber den medizinischen Standard in unzulässiger Weise selbst bestimmt, so der BGH.
Weiter führte der BGH aus, dass es sich bei der Einstufung eines ärztlichen Fehlverhaltens als „grob“ um eine juristische Wertung handelt, die dem Tatrichter obliegt. Diese wertende Entscheidung müsse aber in vollem Umfang durch die vom ärztlichen Sachverständigen mitgeteilten Fakten getragen werden und sich auf die medizinische Bewertung des Behandlungsgeschehens durch den Sachverständigen stützen müssen.
Diese Beanstandung des vorangegangenen OLG-Urteils, in welchem ein Behandlungsfehler (in Form eines Befunderhebungsfehlers) abgelehnt worden war, durch den Haftungssenat überrascht kaum, erklärt Prof. Dr. jur. A. Spickhoff aus München in einem Kommentar in der „Juristen Zeitung“. Wenn ein Gericht das tun wolle und sich dabei gegen übereinstimmende Empfehlungen in Leitlinien, das Fachschriftum und einen eingeschalteten Sachverständigen entscheide, dann nehme es nicht Wunder, dass ein solcher Schritt eines ganz besonderen Begründungsaufwandes bedürfe. Dabei komme es hier auf die Frage, wie verbindlich Leitlinien (und unter welchen Bedingungen) seien, nicht einmal an.
(Versicherungsrecht 66 (2015), 17: 712-715 und Juristen Zeitung 70 (2015), 11: 573–578)
Gerd-Marko Ostendorf, Wiesbaden