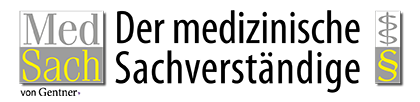Wer in der Kindheit Opfer sexueller Gewalt wurde, hat ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter erneut derartige Traumata zu erfahren. Dieses als Reviktimisierung bezeichnete Phänomen ist bereits seit Längerem bekannt und gut beschrieben. Welche psychischen Mechanismen ihm zugrundeliegen ist bislang allerdings nur unzureichend geklärt. Nach Ansicht von Estelle Bockers und Professor Dr. Christine Knaevelsrud liegt, neben verschiedenen weiteren Faktoren, eine mögliche Ursache in Bindungsmustern, die in der Kindheit erlernt wurden. In der Fachzeitschrift „PiD Psychotherapie im Dialog“ geben die beiden psychologischen Psychotherapeutinnen, die an der Freien Universität Berlin tätig sind, einen Überblick darüber, welche Rolle bindungsbezogene Aspekte bei der Reviktimisierung spielen könnten.
„Nach der Bindungstheorie prägen frühe Bindungserfahrungen die Vorstellung davon, was eine Beziehung ausmacht“, erläutert Bockers, die sich im Rahmen ihrer Promotion mit dem Thema Reviktimisierung beschäftigt. Bereits in der Kindheit formt sich demnach ein stabiles Bild davon, was man in einer Beziehung zu erwarten hat, wie andere sich in Beziehungen verhalten und wie man selbst sich zu verhalten hat. Eine warme, fürsorgliche und liebevolle Umgebung lässt in einem Kind die Überzeugung wachsen, es wert zu sein, positiv und liebevoll behandelt zu werden. Umgekehrt sorgen abweisende, in ihrem Verhalten unvorhersehbare und missbräuchliche Bezugspersonen dafür, dass das Kind sich selbst für wertlos hält. „Außerdem entsteht ein inneres Bindungsmodell, nach dem Beziehungspartner generell missbrauchend und wenig einschätzbar sind“, sagt Bockers und verweist auf Studien, nach denen diese früh erworbenen Bindungsmuster die Wahl späterer Beziehungspartner beeinflussen.
Infolge früher Beziehungserfahrungen könne ein eher sicherer oder eher unsicherer Bindungsstil entstehen. In Studien habe sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch in der Kindheit und der Entwicklung eines unsicheren Bindungsstils ergeben. Unsichere Bindungsstile zeichnen sich durch erhöhte bindungsbezogene Angst oder erhöhte bindungsbezogene Vermeidung aus. „Während Menschen mit hoher bindungsbezogener Vermeidung sich in nahen, emotionalen Beziehungen unwohl fühlen, haben Personen mit hoher bindungsbezogener Angst ein starkes Bedürfnis nach Nähe und große Angst, verlassen zu werden“, umreißt Bockers kurz die wichtigsten Charakteristika dieser beiden Beziehungsdimensionen. Dabei scheint besonders hohe bindungsbezogene Angst das Risiko für Reviktimisierung zu erhöhen.
Während die einmal erlernten Bindungsmodelle und der daraus resultierende Bindungsstil lange Zeit als unveränderbar galten, vertreten Bockers und Knaevelsrud die Ansicht, dass diese durchaus durch neue Beziehungserfahrungen verändert werden können. Der Teufelskreis aus unguten Bindungserlebnissen und der Suche nach immer wieder ähnlichen Bindungen, die wiederum das erlernte Muster bestätigen, könne durch psychotherapeutische Interventionen durchbrochen werden, so die beiden Wissenschaftlerinnen. Das eröffne die Möglichkeit, einer Reviktimisierung therapeutisch vorzubeugen. Hierzu müssten die zugrundeliegenden Mechanismen – wie etwa bindungsbezogene Angst – frühzeitig therapeutisch erkannt und bearbeitet werden.
(E. Bockers und C. Knaevelsrud: Sexuelle Reviktimisierung PiD Psychotherapie im Dialog (2014), 15 (1): 78–80)
Thieme Presseservice