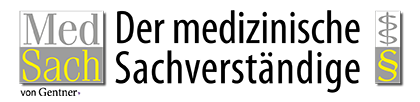Erhebt ein Patient den Vorwurf eines „klassischen“ Behandlungsfehlers, muss er diesen beweisen, in der Regel mittels eines Sachverständigengutachtens auf Basis der Behandlungs- und Pflegedokumentation, erklärte der Rechtsanwalt Wolfgang Putz, Kanzlei für Medizinrecht in München, auf dem 9. Interdisziplinären Update Gefäßmedizin am 16. und 17. März 2018 in Mainz.
Verstößt der Arzt bei der Durchführung einer indizierten Behandlung teilweise gegen den Standard, so ist meist völlig offen, ob der Gesundheitsschaden des Patienten auf diesem teilweisen Verstoß beruht. Vor allem kann der Arzt einwenden, auch bei korrekter Durchführung der indizierten Behandlung könne es zum gleichen negativen Ergebnis kommen.
Letztendlich wird es kaum zu einer Haftung kommen, wenn die Folge des Behandlungsfehlers auch durch Verwirklichung eines operationsimmanenten Risikos eintreten hätte können. Der Patient, der fehlerhaft behandelt wird, kann nicht besser gestellt werden als der Patient, der das gleiche negative Ergebnis ohne Behandlungsfehler durch Verwirklichung eines operationsimmanenten Risikos erleidet.
Nur selten liegt die Beweislast beim Behandlungsfehler umgekehrt (Beweislastumkehr), so dass nicht der Patient den Fehler, sondern der Arzt oder die Klinik die Fehlerfreiheit des eigenen Verhaltens beweisen muss. Dies ist etwa der Fall, wenn es sich bei dem Schädigungsereignis um ein voll beherrschbares Risiko handelt. Meist geht es dabei um Organisation und Koordination des Behandlungsgeschehens sowie um Zustand und Funktion von Geräten und Materialien oder um die Einhaltung der Hygienestandards. Klassischer Fall ist der Sturz von Behandlungs-, Untersuchungs- oder Röntgenliegen.
Für alle Bereiche der Medizin gibt es einen Facharztstandard; er bestimmt die Rechtsprechung und hat stets eine Bandbreite. Der Patient hat keinen Anspruch auf die beste Behandlung, sondern nur auf eine Behandlung innerhalb der Bandbreite des Standards.
Es gibt keine Erfolgshaftung, auch wenn die Patienten das gerne anders sehen, so Putz. Der Arzt schließt mit dem Patienten einen Dienst- und keinen Werkvertrag ab. Daher schuldet er nicht die Wiederherstellung der Gesundheit, sondern (nur) eine Heilbehandlung nach dem ärztlichen Standard. Der Arzt muss diejenigen Kenntnisse haben und die Maßnahmen ergreifen, die bei einem gewissenhaften und aufmerksamen Arzt seines Fachbereichs vorausgesetzt bzw. erwartet werden.
Ein Verstoß gegen den Standard ist regelmäßig ein Behandlungsfehler. Im Zivilrecht gilt der objektivierte zivilrechtliche Fahrlässigkeitsbegriff (§ 276 Abs. 1, Satz 2 BGB). Der Arzt hat die für sein Fachgebiet erforderliche Sorgfalt und damit den Facharztstandard seines Gebietes zu beachten. Anders als im Strafrecht ist mit Fahrlässigkeit also nicht das persönliche Verschulden gemeint, sodass der Arzt für ein Abweichen vom Standard auch dann haftungsrechtlich einzustehen hat, wenn dies aus seiner persönlichen Lage heraus vielleicht subjektiv als entschuldbar erscheinen mag. Im Bereich der Haftung kann das Recht „härter“ sein, weil diese Härte durch eine Versicherung abgefangen wird.
Auch bei Notfällen gilt ein Mindeststandard, aber man darf für einen Notdienst leistenden Arzt etwa nachts im Kreiskrankenhaus nicht den gleichen Maßstab anlegen wie für hoch spezialisierte Fachkliniken oder Fachärzte in planbaren Situationen. Muss beispielsweise ein Chirurg, Orthopäde oder Gynäkologe im Notdienst in Gebieten außerhalb seines Facharztgebietes behandeln, so setzt die Rechtsprechung niedrigere Sorgfaltsmaßstäbe.
Andererseits kann ein Übernahmeverschulden zur Haftung führen, wenn der Arzt Behandlung eines Patienten übernimmt, der er nicht gewachsen ist, und zusätzlich die Verlegung in eine entsprechend qualifizierte Klinik ohne Schaden für den Patienten möglich und damit geboten gewesen wäre. Aktuell zu beobachten ist eine Debatte zur Einbeziehung von Psychiatern oder gar nicht mehr praktisch tätigen Ärzten in den Notdienst.
Die Richtlinien der Bundesausschüsse der Ärzte (bzw. Zahnärzte) und Krankenkassen sind nach den §§ 91 ff. SGB V verbindlich und legen faktisch einen Mindeststandard fest. Diese Kriterien gelten in der Regel auch für die Behandlung von Privatpatienten.
So ist das Sachverständigengutachten „Kern und Kernproblematik“ des Medizinrechts. „Sachverständiger“ ist kein geschützter Begriff; es steht den Gerichten und den Ärztekammern sowie den Versicherungen und den Patienten mehr oder weniger frei, wen sie als Sachverständigen benennen und akzeptieren. Immerhin ist jeder, der ein Sachverständigengutachten im medizinischen Bereich erstellt, mittlerweile für eine fehlerhafte Begutachtung haftpflichtig, berichtete Putz.
Der Patient kann seine Klage ebenso auf interne sachverständige Beratung seines Rechtsanwalts aufbauen wie auf umfangreiche Gutachten von Ordinarien des entsprechenden Fachgebiets. Doch auch diese sind und bleiben „Privatgutachten“, also ein substantiierter Sachvortrag.
Inhaltsgleiche Gutachten – etwa für die Gutachtenstellen oder für das Gericht erstellt – haben dagegen eine ganz andere Bedeutung. Diese Gutachter werden naturgemäß zu „Richtern in Weiß“, auch wenn die „Kollegen in Schwarz“ das nicht gerne hören, so Putz.
Doch auch hier verlangt die Rechtsprechung, dass seitens des Gerichts einem qualifizierten Privatgutachten nicht weniger Beachtung geschenkt werden darf. Das Gericht muss sich damit auseinandersetzen bzw. dafür sorgen, dass sich der Gerichtsgutachter damit auseinandersetzt, so die ständige Rechtsprechung.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden