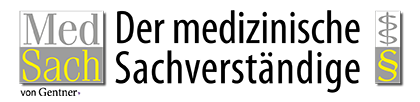Auch wenn sie immer noch mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt sind – psychische Störungen zählen zu den häufigsten und folgenschwersten Erkrankungen. In Deutschland sind rund 43 Prozent der Menschen mindestens einmal im Leben von einer solchen Erkrankung betroffen, und das mit zum Teil schwerwiegenden Folgen: „Fast 27 Prozent aller Frühberentungen gehen auf Störungen der Psyche zurück“, sagt Sandra Dietrich von der Arbeitsgruppe Geschlechterforschung in der Medizin an der Universität Leipzig. Wie stark psychische Erkrankungen die Erwerbsfähigkeit einschränken und welche Rolle das Geschlecht der Betroffenen dabei spielt, hat die Medizinerin gemeinsam mit ihrer Kollegin Katarina Stengler in einer aufwändigen Literaturarbeit untersucht. Die Ergebnisse stellen sie in der Fachzeitschrift „Das Gesundheitswesen“ vor.
In der Fachliteratur fanden die Leipziger Medizinerinnen insgesamt 46 Arbeiten, die sich mit dem Einfluss psychischer Krankheiten auf Fehlzeiten am Arbeitsplatz und/oder Erwerbsunfähigkeit beschäftigten. Dabei bestätigte sich die Annahme der Forscherinnen, dass Frauen häufiger und tendenziell auch länger wegen psychischer Störungen der Arbeit fernbleiben. „Hierfür gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten“, sagen Dietrich und Stengler. Zum einen nehmen Frauen generell früher und häufiger Gesundheitsleistungen in Anspruch. Zum anderen werden psychische Erkrankungen bei Frauen auch leichter diagnostiziert als bei Männern. Zugleich tendieren Ärzte jedoch dazu, die Schwere dieser Störungen bei Frauen zu unterschätzen – dies kann zu kürzeren, aber häufigeren Fehlzeiten führen. „Möglicherweise spielen auch hormonelle Einflüsse eine Rolle – etwa während der Wechseljahre“, sagt Sandra Dietrich. Auch die besondere Belastung arbeitender Frauen, die zugleich den Großteil der Familienaufgaben übernehmen, sei eine mögliche Ursache.
Dass Männer professionelle Hilfe oft erst mit Verzögerung in Anspruch nehmen, wirkt sich auf lange Sicht womöglich negativ auf den Krankheitsverlauf aus. „In zwölf Studien zeigte sich ein erhöhtes Risiko für Erwerbsunfähigkeit bei Männern; nur sieben Arbeiten zeigten das Gegenteil“, fasst Dietrich den Stand der Literatur zusammen. Bei Frauen sei die frühe Hilfesuche dagegen mit einem früheren Rückgang psychischer Probleme und einer früheren Behandlung zur Vermeidung von Erwerbsunfähigkeit verbunden.
Aus diesen Unterschieden ergeben sich für die Leipziger Medizinerinnen erste Ansätze für eine geschlechtsspezifische Prävention von Fehlzeiten und Erwerbsunfähigkeit. Die höhere Hemmschwelle, die Männer offenbar davon abhält, frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen, müsse abgebaut werden. Gerade Depressionen müssten frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden. Bei Frauen wäre ein möglicher Ansatzpunkt die Verbesserung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen – etwa eine leichtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf Risikogruppen wie etwa Männer und Frauen mit niedrigem Einkommen gerichtet werden. Und für beide Geschlechter raten Dietrich und Stengler dazu, spezielle Konsultationen zur Rückfallprävention anzubieten, sobald die ersten Fehlzeiten aufgrund einer psychischen Störung aufgetreten sind.
(Dietrich S et al.: Geschlechtsspezifische Analyse von Fehlzeiten am Arbeitsplatz und Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen – ein systematischer Literaturreview. Das Gesundheitswesen (2013), 75, 6: 393–394)
Thieme Presseservice