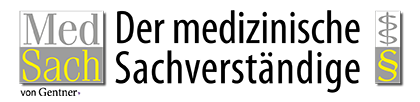LSG Thüringen, Beschluss vom 28.Oktober 2024 - L 1 JVEG 195/24
Tenor
Die Entschädigung für das Gutachten vom 23. November 2020 wird auf 30.644,87 € festgesetzt.
Eine Beschwerde an das Bundessozialgericht findet nicht statt.
Gründe
I.
Im Klageverfahren mit dem Az. L 1 U 1364/17 beauftragte der damals zuständige Berichterstatter des 1. Senats mit Beweisanordnung vom 22. Mai 2019 den Erinnerungsgegner mit der Erstellung eines Gutachtens nach § 106 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG).
Die Beweisanordnung lautete wie folgt:
1.) Liegen bei dem Kläger die arbeitstechnischen Voraussetzungen der Berufskrankheit Nr. 2108 der Anlage I zur BKV (Berufskrankheitenverordnung) entsprechend des Merkblattes zu der Berufskrankheit Nr. 2108 (abgedruckt u.a. Mertens/Brandenburg, Die Berufskrankheitenverordnung, M 2108) vor?
Sofern an einzelnen Prüfpunkten zwischen den von
a) der Beklagten angenommenen
b) dem Kläger vorgetragenen
c) nach ihrer Auffassung zutreffenden
Kriterien/Annahmen Abweichungen bestehen, machen Sie diese bitte deutlich und würdigen Sie diese. Machen Sie dabei bitte auch deutlich, welche Folgen die abweichenden Kriterien für die weitere Beurteilung haben.
2.) Ist die Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens erforderlich? Wenn ja, welches?
Sofern der Sachverhalt noch nicht hinreichend ausermittelt ist, teilen sie dies bitte mit. Ermittlungen, die von Ihnen selbst vorgenommen/eingeholt werden können, werden hiermit beauftragt. Ermittlungen, die weitere Prüfungen/Nachforschungen erfordern, geben sie bitte so genau als möglich an (Was ist noch erforderlich? Bei wem ist dieses zu erfragen? Wer kann hinzugezogen oder beauftragt werden?).
Mit Schreiben vom 18. Juni 2019 ersuchte der Erinnerungsgegner um Genehmigung, den Kläger telefonisch zu Details seiner beruflichen Wirbelsäulenbelastung befragen zu dürfen. Durch Verfügung vom 19. Juni 2019 erteilte der damalige Berichterstatter diese Erlaubnis. Zur Vermeidung von Missverständnissen wurde gebeten, die Erkenntnisse des Telefonats schriftlich zusammenzufassen und sich vom Kläger bestätigen zu lassen. Daraufhin wandte sich der Erinnerungsgegner mit Schreiben vom 25. Juni 2019 an den Kläger und bat diesen unter Schilderung der Erlaubnis durch den Berichterstatter des Senats um Mitteilung einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Nach mehrfacher Fristverlängerung erstattete der Erinnerungsgegner am 23. November 2020 sein Sachverständigengutachten (Eingang am Landessozialgericht am 30. November 2020). Dieses umfasst einschließlich dreiseitigem Literaturverzeichnis 456 Seiten. Auf Seite 66 seines Gutachtens führte er aus, dass die Belastungsangaben auf den Ergebnissen der ausführlichen Arbeitsanamnese beruhen. Dem Senat werde empfohlen, die Angaben des Klägers zumindest stichprobenartig durch Zeugenbefragungen zu überprüfen.
Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle leitete die Akten an die Bezirksrevisorin zwecks Prüfung weiter und informierte hierüber den Erinnerungsgegner mit Schreiben vom 19. Januar 2021. Die Bezirksrevisorin als Vertreterin des Erinnerungsführers führte in einem Schreiben vom 27. Januar 2021 aus, dass die Abrechnung des Erinnerungsgegners weit über dem liege, was das Gericht und die Beteiligten erwartet hätten. Bei Ansetzung eines Vergleichsmaßstabes für arbeitsmedizinische Gutachten bestünden erhebliche Zweifel an der Plausibilität der Abrechnung. Sie formulierte daraufhin Fragen hinsichtlich des Zeitaufwandes für die schriftliche Beurteilung, Diktat und Korrektur des Gutachtens und dem Zeitaufwand für Aktendurchsicht und Befragung des Klägers. Sie erklärte sich damit einverstanden, dem Erinnerungsgegner 3.000,00 € als Vorschuss zu zahlen. Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle formulierte daraufhin entsprechende Fragen an den Erinnerungsgegner mit Verfügung vom 4. Februar 2021. Zugleich wies sie den Vorschuss in Höhe von 3.000,00 € an. Mit Schreiben vom 14. April 2021 führte der Erinnerungsgegner aus, dass er die Zeit für die Anfertigung des Gutachtens mit Ausnahme der Dauer der telefonischen Befragung des Klägers nicht notiert habe. Er habe sich dabei an der Rechtsprechung des Kostensenats des Hessischen Landessozialgerichts orientiert, wonach es nicht auf die für die Gutachtenerstellung individuell aufgewandte Zeit ankomme, sondern auf diejenige, die ein Sachverständiger durchschnittlich benötige. Der Annahme der Bezirksrevisorin, dass die Auswertung von einer Software vorgenommen worden sei, sei zu widersprechen. In dem Gutachten werde im Rahmen der Anamneseerhebung auf Seite 3 bis 61 die beruflichen Wirbelsäulenbelastungen des Klägers im Sinne der BK 2108 dargestellt. Daraus folge jedoch noch keine Bewertung der beruflichen Wirbelsäulenbelastungen nach dem Mainz-Dortmunder-Dosismodell (MDD). Diese Bewertung habe nach der Rechtsprechung des BSG in verschiedenen Schritten zu erfolgen. Ein wesentlicher gutachterlicher Schritt bestehe darin, aus den Angaben in der Arbeitsanamnese die MDD-Teildosis während der einzelnen Zeitabschnitte zu berechnen. Die Berechnung sei mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel der Firma Microsoft erfolgt. Dafür habe er bestimmte Angaben in das Tabellenkalkulationsprogramm eingeben müssen. Daraus habe das Programm die Druckkraft berechnet. Aus diesen Angaben sei dann anschließend die MDD-Gesamtdosis in der Tabelle 99 ermittelt worden.
Mit am 25. Oktober 2021 beim Senat eingegangenem Schriftsatz hat die Bezirksrevisorin als Vertreterin des Erinnerungsführers gerichtliche Festsetzung der Vergütung hinsichtlich des am 23. November 2020 erstatteten arbeitsmedizinischen Gutachtens beantragt. Der Erinnerungsgegner sei gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) selbst anspruchsberechtigt. Er sei durch Beweisanordnung vom 22. Mai 2019 beauftragt worden, ein arbeitsmedizinisches Gutachten zu erstatten. Aus der Bitte des Erinnerungsgegners vom 18. Juni 2019, mit dem Kläger telefonieren zu dürfen, ergebe sich, dass diesem wesentliche tatsächliche Feststellungen für die Erstellung des Gutachtens gefehlt hätten. Mit dem Ersuchen, mit dem Kläger telefonieren zu dürfen, habe der Erinnerungsgegner aber seinen Pflichten aus § 407a Abs. 4 Satz 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) nicht Genüge getan. Vielmehr wäre er verpflichtet gewesen mitzuteilen, dass er die arbeitstechnischen Voraussetzungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht feststellen könne und hätte das Gericht um die Durchführung weiterer Ermittlungen bitten müssen. Aus der Zustimmung des Gerichts vom 19. Juni 2019 habe er auch nicht schließen dürfen, Ermittlungen anstellen zu dürfen. Die eigentliche Problematik, dass wesentliche tatbestandliche Feststellungen noch fehlten, sei aus der Anfrage überhaupt nicht hervorgegangen. Das Gericht habe mit einem solchen Tätigwerden des Sachverständigen, insbesondere den umfangreichen Telefonaten, nicht rechnen müssen. Dieser Verstoß führe bereits zum Verlust des Vergütungsanspruchs nach § 8a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 JVEG. Des Weiteren habe der Erinnerungsgegner tatbestandliche Ermittlungen angestellt. Dies falle nicht in sein Aufgabengebiet und führe ebenfalls zum Verlust des Vergütungsanspruchs. Für den Fall, dass das Gericht das Gutachten für verwertbar halte, habe der Erinnerungsgegner des Weiteren gegen § 407a Abs. 4 Satz 2 ZPO verstoßen. Denn er habe es unterlassen, dem Gericht anzuzeigen, dass seine Vergütung ganz erheblich außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes stehe. Bezüglich des geltend gemachten Zeitaufwandes bestünden hinsichtlich der Aktendurchsicht keine Bedenken. Der Zeitaufwand für die Befragung des Klägers sei nicht vergütungsfähig, weil diese Vorgehensweise unzulässig gewesen sei. Soweit der Erinnerungsgegner 451 Stunden Zeitaufwand für die Abfassung der schriftlichen Beurteilung geltend mache, verkenne der Erinnerungsgegner, dass diese formelhaften Berechnungen nicht für die Geltendmachung des Vergütungsanspruchs herangezogen werden dürften, sondern einzig und allein der Plausibilitätsprüfung dienten. Es finde keine Berücksichtigung, dass ein beträchtlicher Teil der Rechenarbeit mithilfe von Excel ausgeführt worden sei. Ein Zeitaufwand von 76 Stunden für Diktat und Korrektur sei nicht realistisch. Gegen die Honorargruppe M2 bestünden keine Bedenken.
Diesen Ausführungen ist der Erinnerungsgegner entgegengetreten. Seine Anfrage an den Senat vom 18. Juni 2019 sei eindeutig gewesen. Aus dieser habe sich ergeben, dass Details zur Wirbelsäulenbelastung des Klägers fehlten. Er habe daher nach Erteilung der Genehmigung des Senats zu Telefonaten davon ausgehen dürfen, dass diese erstattungsfähig seien. Er habe ein arbeitsmedizinisches Gutachten erstellt. Auch den weiteren Ausführungen der Bezirksrevisorin sei zu widersprechen. Vergütungsfähig sei der einem durchschnittlichen Sachverständigen entstehende Aufwand. Er habe verschiedene solcher Gutachten bereits in der Vergangenheit erstellt und nie habe es bei der Vergütungsfestsetzung Probleme gegeben.
Auf übereinstimmenden Antrag der Beteiligten hat der Senat durch Beschluss vom 7. März 2023 das Ruhen des Verfahrens bis zum Abschluss des Verfahrens L 1 U 1364/17 angeordnet.
Durch Urteil vom 19. Dezember 2023 hat der Senat im Verfahren L 1 U 1364/17 eine Entscheidung über die Berufung der Beklagten getroffen.
Daraufhin wurde das Verfahren wiederaufgerufen und fortgesetzt. Den Beteiligten wurden die Niederschriften über die mündliche Verhandlung vom 14. bzw. 19. Dezember 2023 und das Urteil vom 19. Dezember 2023 im Verfahren L 1 U 1364/17 zugeleitet und das Verfahren fortgesetzt.
Der Erinnerungsführer hat nach Einsicht in das Urteil des Senats vom 19. Dezember 2023 ausgeführt, dass er seine vorgetragenen Bedenken hinsichtlich der Verwertbarkeit des Gutachtens als solches und die Abrechenbarkeit der Befragung des Klägers nicht mehr aufrechterhalte. An seinen Beanstandungen im Hinblick auf den Verstoß gegen § 118 SGG, § 407a Abs. 4 Satz 2 ZPO und seinen Einwänden hinsichtlich des Zeitaufwandes für die Gutachtenserstellung halte er fest.
Auf Anfrage des Erinnerungsgegners hat der Senat mitgeteilt, dass das Verfahren L 1 U 1364/17 nach § 183 SGG gerichtskostenfrei war und daher ein Wert des Streitgegenstandes nicht festgelegt wird. Der Erinnerungsgegner hat daraufhin an seiner Auffassung festgehalten, dass die Kosten für das Gutachten nicht außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen. Darüber hinaus sei ihm zum Zeitpunkt der Abfassung seines Gutachtens der Wert des Streitgegenstandes nicht bekannt gewesen. Der vom Senat erteilten Genehmigung zur telefonischen Befragung des Klägers sei eine zeitliche Begrenzung nicht zu entnehmen gewesen. Bei der telefonischen Befragung des Klägers habe er sich handschriftliche Notizen zu seiner beruflichen Wirbelsäulenbelastung gemacht und diese anschließend in Form einer schriftlichen Arbeitsanamnese umgesetzt. Diese Arbeitsanamnese sei Teil seiner gedanklichen Auseinandersetzung und somit Teil der Beurteilung. Er habe als Co-Autor das MDD mitentwickelt. Bis zum heutigen Tag existiere keine frei verfügbare Software, mit der die MDD-Beurteilungs- und Lebensdosis berechnet werden könne. Daher habe er für diese Zwecke das Programm Microsoft Excel programmiert, um die Beurteilungsdosis nach der Gleichung 1 auf Seite 63 seines Gutachtens zu berechnen. Nach der Berechnung der MDD-Beurteilungsdosis habe er die Tabellen 2 bis 99 handschriftlich vorbereitet und dann seiner Sekretärin gegeben. Er halte an seiner Auffassung fest, dass für die Erarbeitung einer Seite mit Tabellen für die Berechnung der MDD-Beurteilungsdosis ein Zeitaufwand von einer Stunde erforderlich sei. Soweit das Thüringer Landessozialgericht in einem Beschluss die Auffassung vertreten habe, dass der Zeitaufwand für die Beurteilung mit einer Stunde pro 1,5 Beurteilungsseiten angenommen werde, weiche diese Rechtsauffassung um 50 % von allen bekannten Entscheidungen der Kostensenate der Bundesländer nach unten ab. Beim JVEG handele es sich um ein Bundesgesetz, das von den Ländern gleichartig umgesetzt werden müsse. Alles andere sei mit Artikel 3 des Grundgesetzes (GG) nicht vereinbar. Die angesetzten 76 Stunden für Diktat und Korrektur des Gutachtens seien erforderlich gewesen. Natürlich sei jede Seite des Gutachtens und auch jede Tabelle daraufhin überprüft worden, ob die handschriftlichen Vorlagen korrekt übernommen worden seien.
Der Erinnerungsführer beantragt,
festzusetzen, was rechtens ist.
Der Erinnerungsgegner beantragt,
die Entschädigung für das Gutachten vom 23. November 2020 auf 49.105,64 € festzusetzen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte dieses Verfahrens und des Verfahrens L 1 U 1364/17 Bezug genommen.
II.
Für den Antrag auf richterliche Festsetzung ist der Senat zuständig, nachdem der Berichterstatter das Verfahren nach § 4 Abs. 7 Satz 2 JVEG mit Beschluss vom 25. Oktober 2024 auf diesen übertragen hat.
Der Antrag auf richterliche Festsetzung durch die Staatskasse ist gemäß § 4 Abs. 1 JVEG statthaft und führt zu der Festsetzung der Vergütung für das Gutachten vom 23. November 2020 auf 30.644,87 €.
Maßgeblich sind gemäß § 24 JVEG die Vorschriften des JVEG in der bis 31. Dezember 2020 geltenden Fassung, weil der Erinnerungsgegner als Sachverständiger mit Beweisanordnung vom 22. Mai 2019 vor dem Inkrafttreten der Neufassung des JVEG zum 1. Januar 2021 durch das Gesetz zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwaltsvergütungsrechts und zur Änderung des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 - KostRÄG 2021) vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 3229) herangezogen worden ist.
Vorab ist festzuhalten, dass der Senat hier nicht entscheiden muss, ob das Sachverständigengutachten vom 23. November 2020 wegen Unverwertbarkeit gemäß § 8a Abs. 2 Nr. 2 JVEG nicht zu vergüten ist. Denn der Senat hat das Gutachten des Sachverständigen in seinem Urteil vom 19. Dezember 2023 im Verfahren L 1 U 1364/17 als arbeitsmedizinisches Sachverständigengutachten berücksichtigt und deshalb gilt es gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 JVEG als verwertbar und ist grundsätzlich vergütungsfähig. So hat der Senat auf Seite 25 der Entscheidungsgründe ausdrücklich ausgeführt, dass er keine Bedenken gegen die Verwertung des Sachverständigengutachtens des Erinnerungsgegners hat. Die in einer früheren Verfügung daran geäußerten Zweifel hat der Senat nicht mehr aufrechterhalten.
Des Weiteren kommt eine Kürzung der Vergütung nach § 8a Abs. 3 JVEG nicht in Betracht. Danach ist die Vergütung nach billigem Ermessen zu bestimmen, wenn die geltend gemachte Vergütung erheblich außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes steht und der Berechtigte nicht rechtzeitig nach § 407a Abs. 4 Satz 2 der Zivilprozessordnung auf diesen Umstand hingewiesen hat. Denn § 8a Abs. 3 JVEG i. V. m. § 407a Abs. 4 Satz 2 ZPO findet in gerichtskostenfreien Verfahren nach § 183 SGG keine Anwendung (vgl. in diesem Sinne auch Senatsbeschluss vom 8. November 2018 – L 1 SF 145/18 B –, juris, Rn. 15; Bayerisches LSG, Beschluss vom 17. Dezember 2013 - L 15 SF 275/13, nach juris). Im sozialgerichtlichen Verfahren gilt abweichend von der ZPO, in der der Verhandlungs- oder Beibringungsgrundsatz maßgeblich ist, der Amtsermittlungsgrundsatz. Alle Vorschriften der ZPO, die mit dem Verhandlungs- oder Beibringungsgrundsatz zusammenhängen, sind daher gemäß § 202 SGG nicht anwendbar (vgl. Schmidt in Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14. Aufl. 2023, § 103, Rn. 1). Von der Anwendbarkeit ausgeschlossen sind zudem alle weiteren Regelungen, die auf Ausgestaltungen des zivilgerichtlichen Verfahrens beruhen, die in dieser Form im sozialgerichtlichen Verfahren keine Entsprechung finden. Dazu gehört auch die Regelung des § 407a Abs. 3 Satz 2, 1. Alt. ZPO. Zum einen existiert in den sozialgerichtlichen Verfahren gemäß § 183 SGG ein Streitwert im Sinn des Zivilprozessrechts nicht und auch das wirtschaftliche Interesse der Beteiligten - als potentielles Ersatzkriterium bei einer nur entsprechenden Anwendung - ist kaum quantifizierbar. Die dem Sachverständigen mit § 407a Abs. 3 Satz 2, 1. Alt. ZPO auferlegte Pflicht, den Streitwert zumindest grob zu schätzen wird daher regelmäßig unerfüllbar sein. Darüber hinaus dient die Hinweispflicht des Sachverständigen gemäß § 407a Abs. 3 Satz 2, 1. Alt. ZPO dem Zweck, den Beteiligten Anlass zu der Überlegung zu geben, ob ihnen die Sache dies wert ist. Denn im zivilgerichtlichen Verfahren sind die Kosten von den Parteien, nicht aber wie im sozialgerichtlichen Verfahren gemäß § 183 SGG bei Ermittlungen von Amts wegen von der Staatskasse zu tragen. Insofern unterscheiden sich zivilgerichtliches und sozialgerichtliches Verfahren grundlegend. Im zivilgerichtlichen Verfahren sind für das Gericht und damit die Staatskasse die entstehenden Kosten ohne allzu große Bedeutung, da immer eine der Parteien die Kosten zu tragen hat. Wegen der Parteien und zu deren Schutz hat der Gesetzgeber die Verpflichtung für den Sachverständigen eingeführt. Im sozialgerichtlichen Verfahren gemäß § 183 SGG hingegen ist der Kostengesichtspunkt für die Beteiligten bei den von Amts wegen durchgeführten Ermittlungen grundsätzlich ohne Bedeutung, da nicht sie, sondern die Staatskasse die Kosten zu tragen hat. Der Kostengesichtspunkt hat daher im zivilgerichtlichen Verfahren ein ganz anderes Gewicht für die Parteien, die das Verfahren auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten führen müssen. Insofern sieht der Senat den Anwendungsbereich des § 407a Abs. 3 Satz 2, 1. Alt. ZPO im sozialgerichtlichen Verfahren gemäß § 183 SGG als nicht eröffnet an, da der Grund für die Regelung des § 407a Abs. 3 Satz 2, 1. Alt. ZPO, nämlich der Schutz der Parteien vor unwirtschaftlich hohen Gutachtenskosten, im sozialgerichtlichen Verfahren nicht einschlägig ist und fiskalische Überlegungen den Amtsermittlungsgrundsatz nicht einschränken können, also ein Schutzbedürfnis für das Gericht vor unwirtschaftlich hoher Belastung von der gesetzlichen Systematik nicht vorgesehen ist.
Bei der Entscheidung sind alle für die Bemessung der Vergütung maßgeblichen Umstände zu überprüfen, unabhängig davon, ob sie angegriffen worden sind. Bei der Festsetzung ist das Gericht weder an die Höhe der Einzelansätze noch an den Stundenansatz oder an die Gesamthöhe der Vergütung in der Festsetzung durch den UdG oder den Antrag der Beteiligten gebunden; es kann nur nicht mehr festsetzen, als beantragt ist.
Nach § 8 Abs. 1 JVEG erhalten Sachverständige als Vergütung
1. ein Honorar für ihre Leistungen (§§ 9 bis 11 JVEG),
2. Fahrtkostenersatz (§ 5 JVEG),
3. Entschädigung für Aufwand (§ 6 JVEG) sowie
4. Ersatz für sonstige und besondere Aufwendungen (§§ 7 und 12 JVEG).
Soweit das Honorar nach Stundensätzen zu bemessen ist, wird es nach § 8 Abs. 2 JVEG für jede Stunde der erforderlichen Zeit einschließlich notwendiger Reise- und Wartezeiten gewährt (Satz 1); die letzte bereits begonnene Stunde wird voll gerechnet, wenn mehr als 30 Minuten für die Erbringung der Leistung erforderlich waren (Satz 2 Halbs. 1).
Für die Erstellung des Gutachtens ist nicht die individuelle Arbeitsweise des Sachverständigen und damit die tatsächlich aufgewandte Zeit maßgeblich, sondern gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 JVEG die für die Erstattung des Gutachtens erforderliche Zeit (Bundesverfassungsgericht <BVerfG>, Beschluss vom 26. Juli 2007 - 1 BvR 55/07 – juris, Rn. 22; BGH, Beschluss vom 16. Dezember 2003 – X ZR 206/98, juris, Rn. 11). Diese ist nach einem abstrakten Maßstab zu ermitteln, der sich an dem erforderlichen Zeitaufwand orientiert, den ein Sachverständiger mit durchschnittlichen Fähigkeiten und Kenntnissen braucht, um sich nach sorgfältigem Aktenstudium ein Bild von den zu beantwortenden Fragen machen zu können und nach eingehenden Überlegungen seine gutachterliche Stellungnahme zu den ihm gestellten Fragen schriftlich niederzulegen. Nach pflichtgemäßem Ermessen hat das Gericht nachzuprüfen, ob der Zeitansatz erforderlich war (vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. Juli 2007 - 1 BvR 55/07; BGH, Beschluss vom 16. Dezember 2003 – X ZR 206/98, juris; ThürLSG, Beschlüsse vom 5. März 2012 - L 6 SF 1854/11 B und 21. Dezember 2006 - L 6 B 22/06 SF; Hartmann/Toussaint in Kostenrecht, 50. Auflage 2020, § 8 JVEG, Rn. 39). Zu berücksichtigen sind die Schwierigkeiten der zu beantwortenden Fragen unter Berücksichtigung der Sachkunde auf dem betreffenden Gebiet, der Umfang des Gutachtens und die Bedeutung der Streitsache (vgl. BGH, Beschluss vom 16. Dezember 2003 - X ZR 206/98). Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Angaben des Sachverständigen über die tatsächlich benötigte Zeit richtig sind, wenn sich diese in einem gewissen Toleranzbereich bewegen (vgl. Senatsbeschluss vom 14. Februar 2018 - L 1 JVEG 1189/16; ThürLSG, Beschluss vom 13. August 2013 - L 6 SF 266/13 E, zitiert nach juris). Die Toleranzgrenze beträgt 15 v. H. Werden die üblichen Erfahrungswerte allerdings um mehr als 15 v. H. überschritten, ist eine Plausibilitätsprüfung anhand der Kostenrechnung und der Angaben des Sachverständigen durchzuführen (vgl. Senatsbeschlüsse vom 14. Februar 2018 - L 1 JVEG 1189/16 und 21. März 2019 - L 1 JVEG 1072/18, juris).
Ausgehend von diesen Grundsätzen gliedert sich die Erstellung eines Gutachtens zur Gewährleistung eines objektiven Maßstabs hinsichtlich des erforderlichen Zeitaufwandes in vier vergütungspflichtige Arbeitsschritte (vgl. Senatsbeschluss vom 21. März 2019 – L 1 JVEG 1072/18, juris):
- Aktenstudium und vorbereitende Arbeiten,
- Untersuchung und Anamnese,
- Abfassung der Beurteilung (Ausarbeitung),
- Diktate und Durchsicht (Korrektur).
Diese vom Senat zugrunde gelegten Arbeitsschritte dienen der Strukturierung des Vergütungsanspruchs des Sachverständigen in tatsächlicher Hinsicht, um den vom Sachverständigen angesetzten Zeitaufwand justiziabel prüfen zu können.
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist für das Gutachten vom 23. November 2020 angesichts der übersandten Unterlagen sowie unter Berücksichtigung der üblichen Erfahrungswerte nach der Rechtsprechung des Senats ein Zeitaufwand von 346 Stunden erforderlich. Der Sachverständige hat in seinem Vergütungsfestsetzungsantrag demgegenüber einen Zeitaufwand von 558,2 Stunden geltend gemacht. Damit hat er die üblichen Erfahrungswerte um mehr als 15 v. H. überschritten.
Hinsichtlich des Zeitaufwands für Aktenstudium und Vorgeschichte ist nach der Rechtsprechung des Senats ein Zeitaufwand von 10,25 Stunden plausibel. Dem Sachverständigen wurden Akten in einem Umfang von 820 Blatt übersandt. Der Senat geht (vgl. Senatsbeschluss vom 21. März 2019 - L 1 JVEG 1072/18, juris) davon aus, dass für die Aktendurchsicht pro 80 Blatt eine Stunde erforderlich ist.
Es bestehen keine Bedenken dagegen hinsichtlich des geltend gemachten Zeitaufwandes für die Position Aktenstudium, diesen entgegen dem eigenen Vergütungsfestsetzungsantrag des Erinnerungsgegners zu erhöhen. Nach ständiger Rechtsprechung ist der Senat bei der Festsetzung weder an die Höhe der Einzelansätze noch an den Stundenansatz oder an die Höhe der Vergütung im Antrag der Beteiligten gebunden, er kann nur nicht mehr festsetzen, als beantragt ist. Dabei ist jedoch nicht auf die einzelnen Positionen, sondern nur auf den Gesamtbetrag (Rechnungsbetrag) abzustellen. Eine Bindung an einzelne Berechnungselemente des Antrags, die letztlich nur der Begründung des Antrags zuzurechnen sind, besteht nicht. Innerhalb des beantragten Gesamtbetrages ist das Gericht deshalb nicht an die geltend gemachten Einzelpositionen einschließlich des Stundenansatzes gebunden und berechtigt, einen Austausch bzw. Änderungen vornehmen (OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 14. August 2017 - 2 L 98/13, juris; Bayerisches LSG, Beschluss vom 26. Juni 2012 - L 15 SF 423/09, juris; Schneider, JVEG, 3. Auflage 2018, § 4 Rn. 48). Das Gericht hat daher den Entschädigungs- oder Vergütungsanspruch vollumfassend zu prüfen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass bestimmte Positionen höher in Ansatz gebracht werden als vom Sachverständigen geltend gemacht. Damit geht auch kein Verstoß gegen die Grundsätze der Plausibilitätskontrolle einher.
Der Zeitansatz für die telefonische Befragung des Klägers in Höhe von 23 Stunden begegnet keinen Bedenken. Hinsichtlich der Verwertbarkeit ist darauf hinzuweisen, dass der damals zuständige Berichterstatter des Senats dem Sachverständigen die telefonische Befragung gestattet hat. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 14. Dezember 2023 den Ablauf seiner telefonischen Befragung so geschildert, dass er mit dem Sachverständigen über ein Jahr jeweils eine Stunde lang telefoniert hat. Insoweit bestehen keine Bedenken dagegen, dies so zugrunde zu legen.
Für die Abfassung der Beurteilung ist ein Ansatz von 261,99 Stunden angemessen. Der Arbeitsschritt „Abfassung der Beurteilung“ umfasst die Beantwortung der vom Gericht gestellten Fragen und deren nähere Begründung, also den Teil des Gutachtens, den das Gericht bei seiner Entscheidung verwerten kann, um ohne medizinischen Sachverstand seine Entscheidung begründen zu können. Dazu gehört die diktatreife Vorbereitung der Beurteilung - ohne Wiedergabe der Anamnese, der Untersuchungsergebnisse oder Befunde - einschließlich der Begründung der vom Sachverständigen getroffenen Schlussfolgerung, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit entgegenstehenden Vorgutachten, anderslautenden Befunden sowie die Auseinandersetzung mit kontroversen Meinungen (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 3. Februar 2020 – L 15 KR 690/19 B, juris, Rn. 20). In diesem Arbeitsschritt wird die eigentliche Gedankenarbeit im Zusammenhang mit der Auswertung der erhobenen Befunde, deren Würdigung im Hinblick auf die Beweisfragen sowie die diktatreife Vorbereitung abgegolten. Der Senat geht davon aus, dass ein medizinischer Sachverständiger mit durchschnittlicher Befähigung und Erfahrung für die gedankliche Erarbeitung durchschnittlich eine Stunde für ca. 1 1/2 Blatt benötigt (vgl. Senatsbeschluss vom 21. März 2019 - L 1 JVEG 1072/18, juris; ThürLSG, Beschluss vom 12. September 2014 - L 6 SF 477/14 B). Zu beachten ist, dass es sich dabei nur um einen Anhaltspunkt für die angemessene Stundenzahl handelt, um den Kostenbeamten im Normalfall eine sinnvolle Bearbeitung zu ermöglichen. Wesentlich für die Berechnung der Vergütung ist nach dem Gesetz nicht die Seitenzahl, sondern der erforderliche Zeitansatz, der nur eingeschränkt über die Blattzahl berechnet wird. Maßgebend ist daher im Zweifelsfall der im Einzelfall erkennbare Arbeitsaufwand des Sachverständigen, der im Gutachten zum Ausdruck kommt. Insofern ist in begründeten Sonderfällen durchaus eine Abweichung sowohl positiv wie negativ bei dem genannten Ansatz in Erwägung zu ziehen. Eine Einschränkung auf bestimmte „Normseiten“, die manche Landessozialgerichte vornehmen (vgl. zum Beispiel: LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 18. Mai 2015 - L 12 SF 1072/14 E, juris: 2.700 Anschläge; Bayerisches LSG, Beschluss vom 14. Mai 2012 - L 15 SF 276/10 B: 1.800 Anschläge), kommt allerdings mangels gesetzlicher Grundlage nicht in Betracht (vgl. Senatsbeschluss vom 21. März 2019 - L 1 JVEG 1072/18: ThürLSG, Beschluss vom 26. März 2012 - L 6 SF 132/12 E, jeweils juris). Die Beurteilung kann sich durchaus an mehreren Stellen eines Gutachtens - ohne Reduzierung unter bestimmte Unterschriften (z. B. Zusammenfassung, Beurteilung etc.) - befinden.
Nach diesen Grundsätzen erscheinen die vom Erinnerungsgegner angesetzten 451 Stunden deutlich überhöht. Dabei geht der Senat von folgender, vom Erinnerungsgegner geschilderter Arbeitsweise aus:
Nach Erstellung der Arbeitsanamnese hat der Erinnerungsgegner die MDD-Teildosis während der einzelnen Zeitabschnitte berechnet. Die Berechnung erfolgte mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel der Firma Microsoft, mit der die Berechnung der Beurteilungsdosis DR nach dem MDD entsprechend der Gleichung 1 auf Seite 63 des Gutachtens programmiert wurde. Die erforderlichen Angaben waren in das Tabellenkalkulationsprogramm einzugeben, daraus hat das Programm die Druckkraft berechnet. Diese Angaben mussten anschließend vom Sachverständigen handschriftlich in die Tabelle eingefügt werden. Daraus hat die Schreibkraft die endgültige Tabelle erstellt. Aus allen Zeilen einer Tabelle hat das Programm abschließend die Beurteilungsdosis berechnet. Aus den Angaben in den Tabellen 2 bis 98 wurde dann die MDD-Gesamtdosis berechnet (vgl. Tabelle 99 des Gutachtens). Die MDD-Gesamtdosis ergab sich aus der Summe der Teildosen. Diese Rechenergebnisse mussten wiederum handschriftlich in eine Tabelle eingetragen werden. Da keine frei verfügbare Software für die Berechnung der MDD-Beurteilungs- und Lebensdosis existierte, hat der Erinnerungsgegner für diese Zwecke eine Formel für das Programm Microsoft Excel erstellt, um die Beurteilungsdosis nach der Gleichung 1 auf Seite 63 seines Gutachtens zu berechnen.
Dies zugrunde gelegt ist zu berücksichtigen, dass ein etwaiger Zeitansatz für die Programmierung einer Tabelle für Microsoft Excel nicht erstattungsfähig ist. Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 JVEG sind mit der Vergütung nach den §§ 9 bis 11 JVEG grundsätzlich auch die üblichen Gemeinkosten sowie der mit der Erstattung des Gutachtens üblicherweise verbundene Aufwand abgegolten. Solche gesondert abrechnungsfähigen Aufwendungen sind dem Erinnerungsgegner durch den Einsatz des von ihm entwickelten Programms nicht entstanden. § 12 Abs. 1 Nr. 1 JVEG setzt voraus, dass dem Sachverständigen besondere Aufwendungen aus Anlass der konkreten Gutachtenerstellung entstanden sind. Kosten für Hilfsmittel oder Entwicklungskosten für eingesetzte EDV-Technik zählen nicht dazu. Technischer Aufwand für die Gutachtenerstellung kann allenfalls dann zu einer über die stundensatzmäßige Vergütung hinausgehenden Vergütung führen, wenn die Anschaffungskosten keine üblichen Gemeinkosten sind. Abgesehen davon, dass es bei der Selbstentwicklung bzw. Selbstprogrammierung an Anschaffungskosten fehlt, zählen nach der amtlichen Begründung des Gesetzentwurfes zur Einführung des § 12 JVEG zu den üblichen Gemeinkosten unter anderem „Aufwendungen, die sich aus einer angemessenen Ausstattung mit technischen Geräten … ergeben“, weil diese Aufwendungen bei der Regelung der Honorargruppen berücksichtigt worden und daher vom Stundenhonorar des JVEG abgedeckt seien (BT-Drucksache Pkt. 15/1971 Seite 177ff.; OVG Lüneburg, Beschluss vom 11. September 2014 - 7 OA 39/13, juris). Berechnungsprogramme zur Ermittlung der MDD-Beurteilungs- und Lebensdosis gehören zur angemessenen technischen Ausstattung eines arbeitsmedizinischen Gutachters. Sie zählen daher zu den üblichen Gemeinkosten und können nicht gesondert bei der Vergütung in Anrechnung gebracht werden, auch nicht im Rahmen eines möglichen Zeitaufwandes für ihre Erstellung.
Ausgehend von diesen Grundsätzen umfasst der Beurteilungsteil des Gutachtens insgesamt 393 Seiten. Der Beurteilungsteil im Sachverständigengutachten vom 23. November 2020 beginnt auf Blatt 61 und endet, was den reinen Text angeht, auf Blatt 68, anschließend folgen von Blatt 69 bis Blatt 449 Tabellen zur Ermittlung der MDD-Beurteilungsdosis bzw. Lebensdosis, von der Mitte von Blatt 449 bis 453 zum Ende erfolgt die abschließende Beurteilung und die Beantwortung der Beweisfrage.
Entgegen der vom Erinnerungsgegner vertretenen Auffassung ist die Arbeitsanamnese im Gutachten beginnend auf Blatt 2 zunächst mit der Wiedergabe des Akteninhalts und anschließend der Wiedergabe des Inhalts der umfangreichen Telefonate mit dem Kläger nicht als Beurteilungsteil zu qualifizieren. Denn im Rahmen dieser Arbeitsanamnese werden nur die Ergebnisse des Telefonats mit dem Kläger wiedergegeben. So wird z. B. ausgeführt, wie der Ablauf des Weihnachtsmarktes bei der Stadt E zur Zeit der Tätigkeit des Klägers gestaltet war und z. B. welche Betonfüße mit welchem Gewicht beidhändig oder zu zweit getragen wurden. Hierbei handelt es sich allein um die nachrichtliche Wiedergabe des Inhalts der Akte und der umfangreichen Telefonate mit dem Kläger. Eine Auswertung der erhobenen Befunde bzw. Würdigung des Vorbringens im Hinblick auf die Beweisfrage ist damit nicht verbunden. Die Auswertung der erhobenen Befunde erfolgt vielmehr erst in den anschließend erstellten Tabellen. Dort wird dann die jeweilige MDD-Beurteilungsdosis für die einzelnen Tätigkeitsabschnitte ermittelt. Auch ansonsten ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass die Wiedergabe der Anamnese nicht zum Beurteilungsteil des Gutachtens gehört (vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 10. Januar 2022 - L 15 VG 51/21 B, nach juris). In den Tabellen beginnend auf Seite 69 erfolgt dann die eigentliche Beurteilung zur MDD-Beurteilungsdosis im Rahmen der einzelnen Tätigkeiten des Klägers. Dies führt unter Berücksichtigung der angemessenen Zeit für die Erarbeitung von einer Stunde für ca. 1,5 Blatt zu einer plausiblen Zeit für die Abfassung der Beurteilung von 261,99 Stunden.
Das Vorbringen des Erinnerungsgegners führt nicht dazu, dass hier von einem höheren erforderlichen Arbeitsaufwand auszugehen ist. Soweit er beanstandet, dass die Rechtsprechung des Senats, welche für die Erarbeitung des Beurteilungsteils von einer Stunde für ca. 1,5 Blatt des Beurteilungsteils ausgeht, mit der Rechtsprechung anderer Landessozialgerichte nicht im Einklang stehe, verkennt er, dass es sich dabei nur um einen Anhaltspunkt für den erforderlichen Aufwand handelt. Soweit andere Landessozialgerichte einen Ansatz von einer Stunde für ein Blatt des Beurteilungsteils zugrunde legen, arbeiten sie auf der anderen Seite wiederum mit Standardseiten, was nach der Rechtsprechung des Senats nicht gilt. Darüber hinaus ist es auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass es bei der Rechtsanwendung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann.
Darüber hinaus ist es in der Rechtsprechung anerkannt, dass in begründeten Sonderfällen durchaus eine Abweichung, positiv wie negativ, bei dem genannten Ansatz in Erwägung gezogen werden kann. Hier ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der wesentliche Teil der Beurteilung auf 380 Seiten in Tabellenform erfolgt. Während man bezüglich der Tabellen zur MDD-Beurteilungsdosis bei der Tätigkeit des Klägers für die Firma U in E (Tabelle 2 und Tabelle 3) und bezüglich der Tabelle 3a für die MDD-Beurteilungsdosis für die Tätigkeit als Zeitsoldat konstatieren kann, dass in den jeweiligen Tabellen die Umsetzung der Angaben aus der Arbeitsanamnese und die Ermittlung der jeweiligen MDD-Beurteilungsdosis erfolgt sind und damit in diesen Tabellen der wesentliche Beurteilungsbeitrag für die jeweilige Tätigkeit seinen Ausdruck findet, ist schon bezüglich der anschließenden Tabellen ab Tabelle 4 zur Beurteilung der MDD-Beurteilungsdosis bei der im Rahmen der Tätigkeit für die Firma S festzustellen, dass in diesen Tabellen erhebliche Wiederholungen der Berechnung einzelner Arbeitsschritte enthalten sind. Dies gilt noch vertiefend in den Tabellen 9 bis 98 für die Beurteilung der unterschiedlichen Tätigkeiten des Klägers bei der Stadt E zwischen Februar 2008 und Juli 2011. Dort wiederholen sich sehr viele Punkte, wie z. B. die Arbeit mit Kabelbrücken und Bauzäunen mehrfach. Zwar war es erforderlich, diese Berechnung jeweils für die einzelnen Tätigkeitsschritte durchzuführen und am Ende war auch entsprechend der Arbeitsanamnese die geleistete Anzahl an Tagen einzubeziehen, dennoch bleibt festzuhalten, dass hier ein erheblicher Wiederholungsteil der Ausführungen gegeben ist. Auch unter diesem Gesichtspunkt gelangt der Senat zu dem Ergebnis, dass ein durchschnittlicher Sachverständiger mit dem ermittelten Zeitaufwand sein Gutachten hätte erstellen können.
Der Senat weist ausdrücklich darauf hin, dass er davon Abstand genommen hat, den zu vergütenden Beurteilungsteil deshalb zu kürzen, weil der Erinnerungsgegner es unterlassen hat, nach Erstellung der Arbeitsanamnese vor Ermittlung der jeweiligen Teil-MDD-Dosis das Ergebnis der Arbeitsanamnese dem Senat vorab zur Verfügung zu stellen. Die vom Erinnerungsgegner auf Seite 66 seines Gutachtens empfohlene stichprobenartige Überprüfung der Angaben des Klägers durch Zeugenvernehmungen hätte sehr wahrscheinlich den Beurteilungsteil reduzieren können. Da der Senat aber bereits erhebliche Wiederholungen der Berechnung einzelner Arbeitsschritte bei der Ermittlung der erforderlichen Zeit für die Erstellung des Beurteilungsteils berücksichtigt hat, sieht er von einer weiteren Reduzierung ab.
Für Diktat und Korrektur des Gutachtens ist ein Zeitaufwand von 50,66 Stunden anzunehmen. Nach der Rechtsprechung des Senats ist in der Regel für Diktat, Durchsicht und Korrektur eines Gutachtens unter Berücksichtigung der Schreibweise von einem Zeitaufwand von einer Stunde für ca. fünf bis sechs Seiten auszugehen. Diese Herangehensweise kann auf den vorliegenden Fall nicht unbesehen übernommen werden. Es ist zu berücksichtigen, dass der wesentliche Teil des Gutachtens in einem Umfang von 380 Seiten in Tabellenform erstellt worden ist. Lediglich bezüglich des Textteils des Gutachtens (Blatt 2 bis 68 und Blatt 449 unten bis Blatt 456, das heißt für einen Umfang von 76 Seiten) kann auf die übliche Herangehensweise zurückgegriffen werden. Dies bedeutet, dass sich für die 76 Textseiten ein Aufwand für Diktat und Korrektur von 12,66 Stunden ermitteln lässt. Hinsichtlich des Diktat/Korrekturaufwandes für die auf 380 Blatt wiedergegebenen Tabellen hält der Senat einen Ansatz von 38 Stunden für angemessen. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Berechnungen in den Tabellen durch ein rechnergestütztes Programm erfolgt sind (Microsoft Excel). Von daher war es zwar noch erforderlich, die korrekte Übertragung in den Tabellen zu überprüfen, dies ist jedoch anders als bei einem in Textform geschriebenen Gutachtenteil. Hinzukommt, dass, wie bereits ausgeführt, im Rahmen der Tabellen sehr viele Wiederholungen vorhanden sind. Insoweit ist es aus Sicht des Senats ausreichend, einen Korrekturaufwand von einer Stunde pro zehn Blatt für die Tabellen als erforderlich anzusehen.
Daraus folgt, dass unter Anlegung der üblichen Maßstäbe für die Erstattung des Gutachtens von einem erforderlichen Zeitaufwand von gerundet 346 Stunden (10,25 + 23 + 261,99 + 50,66) auszugehen ist. Die beantragten 558,2 Stunden überschreiten damit den Toleranzrahmen, sodass eine abweichende Festsetzung zu erfolgen hat.
Nachdem der Erinnerungsgegner vor dem 1. Januar 2021 herangezogen war, ist die Leistung des Erinnerungsgegners entsprechend der Honorargruppe M2 75,00 € gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 JVEG in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung zu vergüten. Nach § 24 Satz 1 JVEG ist die Vergütung von Sachverständigen nach bisherigem Recht zu berechnen, wenn der Auftrag an den Sachverständigen vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung erteilt worden ist. Diese Regelung führt vorliegend zur Anwendung des bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Rechts, denn der Auftrag an den Erinnerungsgegner ist bis zum 31. Dezember 2020 erteilt worden, weil die Beweisanordnung, mit der der Erinnerungsgegner zum Sachverständigen bestellt wurde, diesem laut Empfangsbekenntnis am 3. Juni 2019 zugegangen ist.
Schlussendlich ergibt sich folgender Zeitansatz:
Hinzu kommen die Schreibauslagen (§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG) und Portokosten (§ 7 Abs. 1 Satz 1 JVEG).
Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 JVEG ist dem Erinnerungsgegner die auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer zu ersetzen. Dabei ist nach § 12 Abs. 1 UStG auf die gesamte Vergütung der Steuersatz von 16 Prozent anzuwenden. Der durch die Sonderregelung des § 28 Abs. 1 UStG in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerrechtlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 auf 16 Prozent abgesenkte Steuersatz kommt zur Anwendung, weil das Gutachten des Erinnerungsgegners am 30. November 2020 und damit unter Geltung des herabgesetzten Steuersatzes beim Landessozialgericht eingegangen ist. In diesem Zusammenhang kann nicht entsprechend § 24 JVEG auf die bis zum 31. Dezember 2020 geltende Fassung des Umsatzsteuergesetzes abgestellt werden. Der Wortlaut und die systematische Stellung des § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 JVEG im Gefüge des Gesetzes, die mit der Kleinunternehmerregelung auf eine dezidiert umsatzsteuerrechtliche Vorschrift verweist, und der Sinn und Zweck der Regelung charakterisieren den Anspruch nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 JVEG als einen Aufwendungsersatzanspruch mit streng umsatzsteuerrechtsakzessorischer Wirkung (vgl. Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschluss vom 11. März 2021 – L 5 AR 368/20 B KO, juris). Die Landeskasse hat „die auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer“ zu ersetzen, um den Sachverständigen von diesen Aufwendungen freizuhalten. In welcher Höhe Aufwendungen entstehen, die dann – ganz oder teilweise – zu ersetzen sind, bestimmt sich aber nicht nach den Regelungen über den Aufwendungsersatzanspruch, sondern nach den vorgelagerten Regelungen des Umsatzsteuerrechts. Zu einer anderen Auslegung könnte man überhaupt nur gelangen, wenn man den § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 (i.V.m. § 2 Abs. 1) JVEG als umsatzsteuerrechtliche Sonderregelung außerhalb des UStG verstehen wollte, wofür nichts spricht. Für die Anwendung des somit maßgeblichen § 28 Abs. 1 UStG kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem der jeweilige Umsatz ausgeführt wird (vergleiche auch Bundesministerium der Finanzen, Anwendungsschreiben vom 30.06.2020, - III C 2 - S 7030/20/10009:004 -, BStBl 2020 I S. 584 Rn. 4). Dies entspricht auch § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) UStG, wonach die Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen bei der Berechnung der Steuer nach vereinbarten Entgelten mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums entsteht, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Frage, welcher Steuersatz zugrunde zu legen ist, ist daher derjenige, in dem der jeweilige Umsatz „ausgeführt“ wird. Dies ergibt sich aus der allgemeinen Übergangsvorschrift des § 27 Abs. 1 Satz 1 UStG, wonach Änderungen des UStG, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 5 UStG anzuwenden sind, die ab dem Inkrafttreten der maßgeblichen Änderungsvorschrift „ausgeführt“ werden. Weder dem Wortlaut des § 28 UStG noch der Gesetzesbegründung zum Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz (vgl. BR-Drs. 329/20 S. 25 f.) kann insoweit entnommen werden, dass auf einen anderen Zeitpunkt als denjenigen der Leistungsausführung abzustellen sein soll (vgl. VG München, Beschluss vom 15. Oktober 2021 – M 11 M 21.30892, juris). Ein vom Gericht in Auftrag gegebenes Sachverständigengutachten, bei dem es sich um einen steuerbaren Umsatz nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG handelt, ist erst zu dem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem es bei Gericht eingeht. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob es sich bei einem vom Gericht in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten um eine Lieferung oder eine sonstige Leistung im Sinne des UStG handelt. Entscheidend ist vielmehr bei beiden Formen steuerbarer Umsätze, wann die steuerbare Leistung vollständig erbracht wird. Dies ist bei einem von einem Gericht in Auftrag gegebenen schriftlichen Sachverständigengutachten erst mit Eingang dieses Gutachtens bei Gericht der Fall. Die Fertigstellung des Gutachtens in der Sphäre des Sachverständigen ist demgegenüber nicht maßgeblich (Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 29. Dezember 2020 – L 15 R 947/20 B; OLG Celle, Beschluss vom 5. November 2021 – 5 StS 2/20, jeweils juris). Dies folgt bereits aus § 118 Abs. 1 S. 1 SGG i.V.m. § 411 Abs. 1 ZPO. Danach schuldet ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger, wenn, wie hier, eine schriftliche Begutachtung angeordnet wird, die Übermittlung des schriftlichen Gutachtens. „Übermittlung“ bedeutet dabei, dass das Gutachten bei Gericht eingehen muss. Hierfür spricht auch § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 JVEG. Danach muss ein Sachverständiger seinen Vergütungsanspruch innerhalb von drei Monaten nach Eingang des schriftlichen Gutachtens bei dem Gericht, das den Auftrag erteilt hat, geltend machen. Darüber hinaus garantiert allein das Abstellen auf den Zeitpunkt des Eingangs des Gutachtens Klarheit über den anzuwendenden Umsatzsteuersatz.
Die Umsatzsteuer ist auch auf die Portokosten zu erstatten. Dass Umsatzsteuer in diesem Sinne auch für Fremdleistungen zu erstatten ist, für die – wie bei Portokosten – selbst keine Umsatzsteuer zu zahlen ist, entspricht der überwiegenden Auffassung in der Rechtsprechung (Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschluss vom 26. Januar 2022 – L 5 AR 30/20 B KO; ThürLSG, Beschluss vom 9. Dezember 2014 – L 6 SF 723/14 E; SG Fulda, Beschluss vom 3. Juni 2015 – S 4 SF 58/14 E, juris, Rn. 37 ff; a.A. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 5. Juli 2021 – L 7 KO 3/20 (U), Rn. 55; jeweils juris). Die Richtigkeit des gefundenen Ergebnisses wird letztlich durch die – hier nicht maßgebliche – zum 1. Januar 2021 in Kraft getretene Einfügung des § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 JVEG durch das Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3229) bestätigt. Nach Halbsatz 2 dieser Vorschrift kann der Sachverständige nunmehr anstelle der tatsächlichen Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsleistungen eine Pauschale in Höhe von 20 Prozent des Honorars fordern, höchstens jedoch von 15,00 €. Auch auf diese Pauschale als Teil des Entgelts (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UStG) ist – wie dort unstreitig auch im Bereich des Rechtsanwaltsvergütungsrechts – die Umsatzsteuer zu berechnen, die nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 JVEG zu erstatten ist. Es kann aber letztlich weder für die Erhebung der Umsatzsteuer noch für den Aufwendungsersatz nach Sachverständigenvergütungsrecht einen Unterschied machen, ob der Sachverständige die Portokosten spitz abrechnet oder pauschaliert geltend macht.
Danach errechnet sich die Vergütung wie folgt:
Das Verfahren ist gebührenfrei; Kosten werden nicht erstattet (§ 4 Abs. 8 JVEG).
Eine Beschwerde an das Bundessozialgericht findet nicht statt (§ 4 Abs. 4 Satz 3 JVEG).
Redaktionell überarbeitete Fassung von P. Becker, Kassel