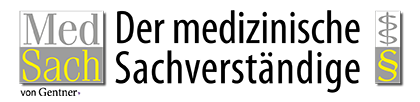Die Menschen aus der Ukraine, die in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland angekommen sind – in der großen Mehrheit Frauen und Kinder – haben zum Teil äußerst bedrohliche Situationen erlebt. Sie wurden aus ihrer sozialen Umgebung gerissen, mussten ihr Hab und Gut, ihre Wohnung, meist auch Familienangehörige zurücklassen und haben oft Kriegsgeschehen und militärische Angriffe erlebt. „Die Menschen sind erschöpft, orientierungslos, ihre Widerstandskraft ist erst einmal verbraucht“, erklärte Kerstin Weidner, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik am Universitätsklinikum Dresden.
Eine enorme psychosoziale Anpassungsleistung als Sturz in eine neue Wirklichkeit mit einer anderen Kultur und schwer zu durchschauenden bürokratischen Hürden – trotz aller Erleichterungen für Flüchtende aus der Ukraine – wird von den Frauen und Kindern verlangt. Diese kann mit Krisen, Angst, Desorientierung, Verlorenheitsgefühl und Zukunftsangst einhergehen und wird auch als „Flüchtlingssyndrom“ beschrieben. Früher bestehende psychische oder psychosomatische Störungen können fortbestehen, sich verdeutlichen oder sich mit anderer Symptomatik zeigen, neue Anpassungsstörungen oder andere psychische beziehungsweise psychosomatische Störungen können auftreten – sowohl bei den Müttern als auch den Kindern.
Wie hoch der Bedarf an psychosozialer oder psychotherapeutischer Hilfe tatsächlich ist, lässt sich jedoch nur schwer abschätzen. „Schätzungen gehen von einem Versorgungsbedarf von 30 Prozent aus“, so Weidner. Es fehle jedoch ein bundesweites Konzept zur Identifizierung und Versorgung besonders gefährdeter oder traumatisierter Geflüchteter; auch seien vorhandene Strukturen überlastet.
Wichtig sei es, einen dringenden psychosozialen Versorgungsbedarf zu erkennen und die Betroffenen an geeignete Stellen weiter zu verweisen – etwa an Psychosoziale Zentren, Trauma-Ambulanzen, Ambulanzen in psychosomatischen oder psychiatrischen Kliniken oder internationale Praxen. Auch müsse es niedrigschwellige Beratungs- und Gesprächsangebote in Erstaufnahmeeinrichtungen geben. „Bei alldem darf es aber nicht zu einer Pathologisierung kommen“, warnte Weidner – schließlich entwickelten nicht alle Geflüchteten eine Traumafolge- oder andere psychische Störung.
Die Themen Krieg und Flucht nehmen seit einigen Jahren einen zunehmend größeren Raum in unserer Gesellschaft ein. „Es ist wichtig, die Versorgungsstrukturen einschließlich Dolmetscherdiensten darauf nachhaltig anzupassen. Geflüchtete, Aufnehmende, Helfer*innen, aber auch älteren Menschen, die aufgrund eigener Kriegserlebnisse Retraumatisierungen erleiden, brauchen niederschwellige Angebote“, betonte Weidner.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden