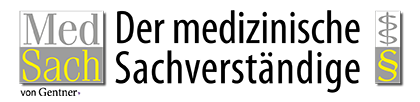Da spezifische diagnostische Marker und evidenzbasierte Behandlungen für das Long-/Post-COVID-Syndrom (PCS) fehlen, werden verschiedene pharmakologische Off-Label-Therapien als mögliche Optionen diskutiert, berichten Sinem Koc-Günel und Maria Vehreschild von der Medizinischen Klinik II am Universitätsklinikum Frankfurt im Hessischen Ärzteblatt. Es handelt sich dabei um potenzielle Therapieansätze, deren Wirksamkeit und Sicherheit im Zusammenhang des PCS jedoch noch nicht ausreichend durch Studien belegt sind.
Vier Jahre nach dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie stehen wir weiterhin vor den langanhaltenden und komplexen Folgen für die Patienten und das Gesundheitssystem. Millionen Menschen weltweit leiden an einem Long-/Post-COVID-Syndrom (PCS), einer vielschichtigen Langzeiterkrankung, die bislang nur unzureichend verstanden ist. Laut aktueller Literatur erleben ca. 10 % bis 20 % der Genesenen einer akuten COVID-19-Infektion langfristige Beschwerden wie Fatigue, kognitive Beeinträchtigungen und körperliche Einschränkungen.
Diagnose und Therapie des PCS bleiben weiterhin eine Herausforderung, da spezifische Biomarker und evidenzbasierte Behandlungsansätze fehlen. Allerdings gibt es mittlerweile vielversprechende Einblicke in die komplexen Hypothesen zur Genese des PCS, aus denen erste Ansatzpunkte für gezielte Therapieoptionen abgeleitet werden können.
Mitochondriale Dysfunktion
So wird etwa eine mitochondriale Dysfunktion als zentrale pathophysiologische Komponente beim PCS intensiv diskutiert. Dabei zeigen Studien eine Vielzahl struktureller und funktioneller Veränderungen in den Mitochondrien, die mit der persistierenden Symptomatik in Verbindung stehen.
Die Rolle mitochondrialer Dysfunktionen als Verbindung zwischen akuten Infektionen und chronischen, nicht-übertragbaren Erkrankungen wird zunehmend erkannt. Studien zeigen, dass mitochondriale Schäden nach SARS-CoV-2-Infektionen, HIV und antiviralen Therapien persistieren können. Diese Dysfunktionen beeinträchtigen die Energieproduktion auf zellulärer Ebene, was zu dauerhaften Symptomen wie Fatigue, Muskelschwäche und kognitiven Einschränkungen führen kann.
Zusammenfassend stellen die Autorinnen fest:
Die Rolle des Mikrobioms
Die Rolle des Mikrobioms, insbesondere des Darmmikrobioms, für die Entwicklung eines PCS wird zunehmend als Schlüsselfaktor in der Pathogenese und der Persistenz der Symptome diskutiert.
Eine Veränderung der physiologischen Zusammensetzung der Mikrobiota steht dabei im Zentrum der Diskussion. Studien belegen eine Assoziation zwischen einer SARS-CoV-2-Infektion und einer veränderten Zusammensetzung der Darmmikrobiota, die mit einer Dysregulation der Immunantwort und verstärkten systemischen Entzündungsprozessen einhergeht.
Veränderungen im Mikrobiom bei PCS könnten nicht nur bakterielle, sondern auch fungale und virale Komponenten umfassen, die potenziell die Immunmodulation und Entzündungsprozesse beeinflussen. Der genaue Mechanismus und die klinische Relevanz dieser Veränderungen sind jedoch noch nicht abschließend geklärt.
Therapeutische Ansätze wie Mikrobiom-Transplantationen oder probiotische Interventionen werden zunehmend untersucht, um das Gleichgewicht der Mikrobiota wiederherzustellen und die Symptome zu lindern. Obwohl erste Studien vielversprechend sind, bleibt die klinische Anwendung begrenzt. Mikrobiom-Transplantationen und ähnliche Ansätze sind weiterhin experimentell, so die Autorinnen. Um entsprechende evidenzbasierte Behandlungsstrategien für das PCS zu entwickeln, seien weitere Studien nötig, um die zugrunde liegenden Mechanismen aufklären.
Konsequenzen aus gutachtlicher Sicht
Aus gutachtlicher Sicht ergibt sich als Konsequenz, dass alternativ- bzw. komplementärmedizinische Behandlungen einer angeblichen „Mitochondriopathie“ oder „Dysbiose“ beim PCS mit umfangreicher spezieller Labordiagnostik und einer oft komplexen Therapie etwa mit Medikamenten, Ozon-Eigenblut-Infusionen, Bioresonanz o. ä. nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung angesehen werden können. Diese fallen somit auch nicht unter die Leistungspflicht etwa der privaten Krankenversicherung (PKV).
Koc-Günel, S., Vehreschild, M. (2025). Long-Covid/Post-Covid-Syndrom: Aktueller Stand der Forschung und klinisches Management. Hessisches Ärzteblatt, 2, 124–129
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden