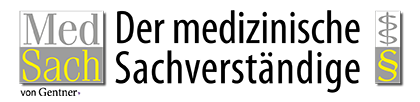In der Zeitschrift „Versicherungsrecht“ wird immer wieder ausführlich über Urteile berichtet, die auch für den medizinischen (Gerichts-)Sachverständigen interessant sind (vgl. Heft 6/2018, S. 254 ff).
Hier wieder eine Zusammenstellung einiger kurzer Referate über entsprechende Publikationen in den letzten Monaten zur Haftpflicht, insbesondere Arzthaftpflicht, zur privaten Unfallversicherung sowie zur privaten Berufsunfähigkeitsversicherung.
Haftpflicht
Schmerzensgeld auch für vorhersehbare Schadensfolgen
Verlangt ein Geschädigter für eine erlittene Körperverletzung uneingeschränkt ein Schmerzensgeld, so werden durch den Klageantrag nicht nur die Schadensfolgen erfasst, die bereits eingetreten und objektiv erkennbar waren, sondern auch diejenigen, deren Eintritt jedenfalls vorhergesehen und bei der Entscheidung berücksichtigt werden konnten, erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 10.7.2018 (AZ: IV ZR 259/15, Karlsruhe).
Der Grundsatz der Einheitlichkeit des Schmerzensgeldes gebietet, die Höhe des zustehenden Schmerzensgeldes aufgrund einer ganzheitlichen Betrachtung der den Schadensfall prägenden Umstände unter Einbeziehung der absehbaren künftigen Entwicklung des Schadensbildes zu bemessen.
Daher durfte sich das (vorher zuständige) Berufungsgericht bei der Bemessung des Schmerzensgeldes nicht darauf beschränken, hinsichtlich der Schmerzsymptomatik nur diejenigen Verletzungsfolgen zu berücksichtigen, die bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bereits tatsächlich eingetreten waren, kritisierte der BGH. Das Berufungsgericht werde daher zu klären haben, worauf die behaupteten fortdauernden Beschwerden, insbesondere die Schmerzsymptomatik, beruhen und wie sie sich auf die Höhe des einheitlich zu bemessenden Schmerzensgeldes auswirken.
Der Sachverständige war nach den Feststellungen des Berufungsgerichts davon ausgegangen, dass insbesondere die Schmerzsymptomatik weiterer Abklärung zugänglich sei. Der Kläger habe sich den vorgeschlagenen weiteren (unfallchirurgischen bzw. auch psychosomatischen) Untersuchungen aber noch nicht unterzogen. Dies werde nachzuholen sein, erklärte der BGH.
(Versicherungsrecht 69 (2018), 23: 1462–1463)
Arzthaftpflicht
Arztbrief mit bedrohlichem Befund muss dem Patienten unverzüglich zur Kenntnis gebracht werden
Wenn ein Arzt einen Arzt-/Krankenhausbrief mit bedrohlichen Befunden (und gegebenenfalls angeratener Behandlung) erhält, hat er sicherzustellen, dass der Patient davon Kenntnis erhält – auch wenn dieser Brief nach einem etwaigen Ende des Behandlungsvertrags bei ihm eingeht, erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 26.6.2018 (AZ: VI ZR 285/17, Düsseldorf). Der Arzt, der als einziger eine solche Information bekommt, muss den Informationsfluss aufrechterhalten, wenn sich aus der Information selbst nicht eindeutig ergibt, dass der Patient oder der diesen weiter behandelnde Arzt sie ebenfalls erhalten hat.
Im vorliegenden Fall ging es um den Arztbrief eines Klinikums, in welchem die Hausärztin nachträglich über den histologischen Befund eines resezierten Nervenscheidentumors im Bereich der Kniekehle informiert worden war. Darin wurde mitgeteilt, dass es sich – entgegen der zunächst vermuteten Diagnose – bei Durchsicht der Präparate im Referenzzentrum um einen malignen Nervenscheidentumor handelte. Der Patient sollte sich in einem onkologischen Spezialzentrum vorstellen.
Eine Weiterleitung dieses Schreibens an den Patienten oder eine sonstige Information durch die Hausärztin war aber nicht erfolgt. Damit hat diese ihre ärztlichen Pflichten gegenüber dem Patienten verletzt: Sie hätte sicherstellen müssen, dass der Patient von diesem Arztbrief und der darin enthaltenen bedrohlichen Diagnose sowie von den angeratenen ärztlichen Maßnahmen unverzüglich Kenntnis erlangte, erklärte der BGH. Das gilt auch dann, wenn der Brief erst nach einem etwaigen Ende des Behandlungsvertrags bei der Hausärztin eingegangen sein sollte (was in diesem Fall zudem umstritten war).
Der Patient hat grundsätzlich Anspruch auf Unterrichtung über die im Rahmen einer ärztlichen Behandlung erhobenen Befunde und Prognosen. Das gilt im besonderen Maß, wenn ihn erst die zutreffende Information in die Lage versetzt, eine medizinisch gebotene Behandlung durchführen zu lassen (therapeutische Aufklärung/Sicherungsaufklärung). Es ist ein (schwerer) ärztlicher Behandlungsfehler, wenn der Patient über einen bedrohlichen Befund, der Anlass zu umgehenden und umfassenden ärztlichen Maßnahmen gibt, nicht informiert und ihm die erforderliche ärztliche Beratung versagt wird, erklärte der Senat.
Erhält der behandelnde Arzt einen Arztbericht, in dem für die Weiterberatung und Weiterbehandlung des Patienten neue bedeutsame Untersuchungsergebnisse enthalten sind, die eine alsbaldige Vorstellung des Patienten bei dem Arzt unumgänglich machen, so hat er den Patienten (sogar dann) unter Mitteilung des neuen Sachverhalts einzubestellen, wenn er ihm aus anderen Gründen die Wahrnehmung eines Arzttermins angeraten hatte. Dabei kommt es nicht darauf an, ob außer dem behandelnden Arzt vielleicht auch andere Ärzte etwas versäumt haben.
Aus der im Arztbrief gerichteten Handlungsaufforderung („Wir bitten Sie, den … Patienten vorzustellen“) hätte die beklagte Ärztin zudem unschwer entnehmen können, dass die Ärzte des Klinikums sie als weiterbehandelnde Ärztin ansahen.
Weiter nahm der BGH Stellung zur Frage, ob dieser Behandlungsfehler als grob zu bewerten ist. Das (vorher zuständige) Berufungsgericht hatte bei seiner Beurteilung dieser Frage – den Ausführungen des medizinischen Sachverständigen folgend – zugrunde gelegt, dass ein grober Behandlungsfehler ausscheide, wenn ein solcher Fehler unter den gegebenen Umständen im alltäglichen Ablauf (der Arztpraxis) passieren könne. Hierzu hatte der Sachverständige ausgeführt, es habe für die Hausärztin kein Anlass bestanden, sich bei Erhalt des Histologiebefundes die Patientenakte nochmals bringen zu lassen und durchzusehen, da sie nicht mehr in die Behandlung einbezogen gewesen sei (was allerdings strittig war).
Dass Fehler im ärztlichen Praxisalltag vorkommen (können), sagt jedoch nichts darüber aus, ob sie objektiv nicht mehr verständlich sind, rügte der Senat. Bei der Einstufung eines ärztlichen Fehlverhaltens als grob handelt es sich grundsätzlich um eine juristische Wertung, die dem Tatrichter und nicht dem Sachverständigen obliegt. Jedoch muss diese wertende Entscheidung des Tatrichters in vollem Umfang durch die vom ärztlichen Sachverständigen mitgeteilten Fakten getragen werden.
Der BGH konnte aus juristischen Gründen nur nachprüfen, ob das Berufungsgericht den Begriff des groben Behandlungsfehlers verkannt oder ob es bei der Gewichtung dieses Fehlers erheblichen Prozessstoff außer Betracht gelassen oder verfahrensfehlerhaft gewürdigt hat. Solche Fehler sind dem Berufungsgericht allerdings unterlaufen, erklärten die Karlsruher Richter.
Schließlich hat das Berufungsgericht bei seiner Bewertung vollständig außer Acht gelassen, dass es sich bei der Beklagten um eine Hausärztin handelte, bei welcher der Kläger langjährig in Behandlung gewesen war. Gerade ein in der Langzeitbetreuung und damit auch interdisziplinären Koordination tätiger Hausarzt muss indes damit rechnen, dass seine Patienten ihn im Rahmen einer Krankenhausbehandlung als Ansprechpartner angeben, führte der BGH aus. Es muss sich ihm aufdrängen, dass er als für die Weiterbehandlung verantwortlicher Arzt angesehen wird und in dieser Funktion die dazu erforderlichen Informationen erhält.
(Versicherungsrecht 69 (2018), 19: 1192–1195)
Zulässigkeit einer Behandlung außerhalb des ärztlichen Standards
Ein Arztbehandlungsvertrag, der eine vom ärztlichen Standard abweichende, auch ihn unterschreitende, Behandlung (üblicherweise als „alternativmedizinische“ Behandlung bezeichnet) vorsieht, ist in Grenzen, die sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und dem Strafgesetzbuch (StGB) ergeben, wirksam, erklärt Karl Nußstein, Vorsitzender der für Arzthaftungsfragen zuständigen Kammer des Landgerichts Regensburg und Lehrbeauftragter an der Universität Regensburg. Er erläutert das an folgendem, am 27.5.2014 vom Landgericht (LG) Regensburg entschiedenen Fall (AZ: 4 O 910/11):
Eine an einem Mammakarzinom erkrankte Patientin war in verschiedenen Kliniken mit den Methoden der „Schulmedizin“ über viele Jahre, aber letztlich erfolglos, behandelt worden. Dann hatte sie sich an einen Arzt gewandt, welcher versuchte, das Wachstum der Tumorzellen mittels einer Galvanotherapie zu stoppen oder wenigstens zu begrenzen. Trotz mehrerer Behandlungen über längere Zeit konnte das Tumorwachstum jedoch nicht aufgehalten werden.
Die Patientin, die vorher umfangreich über die Wirkungsweise und die Risiken der Galvanotherapie aufgeklärt und auch ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass es sich um eine „von der Schulmedizin nicht anerkannte“ Methode handelte, verklagte dennoch den behandelnden Arzt auf Schmerzensgeld, obwohl die Galvanotherapie fehlerfrei angewendet worden war. Die Begründung der Klägerin war, dass durch die bei ihr wirkungslose Galvanotherapie wertvolle Zeit für eine wirksame Behandlung verloren gegangen sei.
Die Klage wurde abgewiesen, da der Behandlungsvertrag angesichts der umfassenden Aufklärung der Klägerin gemäß § 630 BGB nicht anfechtbar war. Somit war die Einwilligung der Klägerin in diese Behandlung wirksam. Da die vertraglich geschuldete Behandlung fehlerfrei durchgeführt worden war, besteht keine Haftung des Arztes, führt Nußstein aus.
(Nußstein K: Ärztliche Behandlung außerhalb des Standards – Anfechtung, Aufklärung und Einwilligung. Versicherungsrecht 69 (2018), 22: 1361–1365)
Private Unfallversicherung
Bemessung des Invaliditätsgrads nach Achillessehnenruptur
Bei dauerhaften Folgen einer Achillessehnenruptur ist die Bemessung des Invaliditätsgrads wegen des anatomischen Sitzes der unfallbedingten Schädigung im unteren Bein nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) grundsätzlich auf den Beinwert und nicht auf den Fußwert der Gliedertaxe abzustellen, erklärte das Berliner Kammergericht (KG) mit Beschluss vom 27.7.2018 (AZ: 6 U 8/18).
Das schließt aber nicht aus, für die Bemessung des Grads der Funktionsbeeinträchtigung der Achillessehne zu berücksichtigen, in welchem Ausmaß diese wiederum die Funktion des rumpfferneren Körperteils, hier also des Fußes, beeinträchtigt, da sich die Funktionsbeeinträchtigung notwendigerweise dort auswirkt. Denn nach der Rechtsprechung des BGH können zur Vermeidung von Widersprüchen im Rahmen der richterlichen Würdigung auch die Wertungen der Gliedertaxe für die in ihrer Funktion beeinträchtigten Glieder oder Gliederteile herangezogen werden.
Schließlich hat es auch der BGH im Urteil vom 14.11.2011 für richtig gehalten, auf die Funktionsbeeinträchtigungen des rumpfferneren Körperteils abzustellen, wenn allein dies schon zu einem höheren Invaliditätsgrad führt als die Funktionsunfähigkeit des rumpfnäheren Körperteils, so die Berliner Richter. In einem solchen Fall stellt die Invaliditätsleistung für das rumpffernere Körperteil die Untergrenze der geschuldeten Versicherungsleistung dar. Somit kann auf den Fußwert abgestellt werden, wenn der sich daraus ergebende Invaliditätsgrad denjenigen des Beinwerts übersteigt.
(Versicherungsrecht 70 (2019), 2: 86–87)
„Chronische Borreliose“ ist keine nachgewiesene pathologische Entität
Die sogenannte „chronische Borreliose“ stellt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine gemäß anerkanntem wissenschaftlichen Standard nachgewiesene pathologische Entität dar, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg mit Beschluss vom 20.06.2018 (AZ: 5 U 36/18) und bestätigte das vorangehende Urteil des Landgerichts, welches die Klage auf Leistungen aus der privaten Unfallversicherung wegen einer Lyme-Borreliose infolge eines Insektenstichs/-bisses abgewiesen hatte.
Nach den zugrunde zu legenden Feststellungen ist die Klägerin nicht an einer Lyme-Borreliose erkrankt; eines weiteren Gutachtens bedarf es nicht, so das OLG. Der vom Landgericht beauftragte Sachverständige hatte überzeugend ausgeführt, dass in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehrmeinung bei der Klägerin nicht von einer manifesten Erkrankung an einer Lyme-Borreliose auszugehen ist.
Die Klägerin bezog sich auf eine privatgutachterliche Äußerung eines Gutachters, der eine abweichende Lehrmeinung etablieren möchte. Diese gutachterliche Stellungnahme war jedoch nicht geeignet, den Nachweis einer manifesten Lyme-Borreliose zur gerichtlichen Überzeugung zu erbringen. Die Einstufung des Privatgutachters, es gebe eine sogenannte „chronische Borreliose“, die sich an diversen Symptomen als Multiorganerkrankung zeige, wird jedoch von der herrschenden Lehrmeinung so nicht akzeptiert.
So heißt es in der seit April 2018 geltenden S3-Leitlinie (vgl. MedSach Heft 4/2018, S. 176 f): „Hinsichtlich der diskutierten Pathophysiologie der vermeintlichen „chronischen Lyme-Borreliose“ bzw. „chronischen Neuroborreliose“ haben aktuelle systematische Reviews keine wissenschaftliche Grundlage für die Annahme einer persistierenden latenten Infektion durch Borrelia burgdorferi […] oder deren morphologische Varianten gefunden […] Feder et al. haben 4 klinische Kategorien beschrieben, denen sich Patienten mit vermeintlicher „chronischer Lyme-Borreliose“ zuordnen lassen […] Keine der 4 Kategorien nach Feder entspricht einer Krankheitsentität.“
Die Oldenburger Richter betonten, dass die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, welche die S3-Leitlinie herausgegeben habe, die mitgliederstärkste Vereinigung von Neurologen Europas mit ca. 9.000 Mitgliedern sei und dass an der Entwicklung der S3-Leitlinie daneben u. a. 20 AMWF-Fachgesellschaften sowie das Robert-Koch-Institut beteiligt waren. Man werde nicht sagen können, dass angesichts dieser Geltungskraft die Klägerin mit dem Privatgutachten den Beweis geführt habe, dass die S3-Leitlinie im Hinblick auf die angesprochenen Punkte explizit falsch sei.
(Versicherungsrecht 70 (2019), 1: 24)
Berufsunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähigkeit trotz Fortsetzung der Berufstätigkeit
Berufsunfähigkeit i. S. der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung (aus psychischen Gründen) kann auch bestehen, wenn der Versicherte seinen Beruf tatsächlich noch ausübt, dabei aber Raubbau an seiner Gesundheit treibt, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm mit Urteil vom 27.4.2018 (AZ: 20 U 75/17).
Es handelte sich um eine Unternehmensgeschäftsführerin einer Unternehmensgruppe mehrerer Gesellschaften mit insgesamt über 500 Mitarbeitern in Deutschland und Polen, die in Insolvenz geraten war, mit sehr langer täglicher Arbeitszeit, auch an den Wochenenden. Diese hatte Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung wegen einer Depressionserkrankung beantragt, ihre anspruchsvolle berufliche Tätigkeit aber weiter ausgeübt.
Der vom Gericht bestellte Sachverständige hat – für das Gericht überzeugend – ausgeführt, dass aufgrund der Schwere dieser Erkrankung die Fähigkeiten der Klägerin derart massiv eingeschränkt waren, dass ihr überhaupt keine differenzierte Tätigkeit mit unternehmerischem Anspruch möglich war oder wenn, dann jedenfalls nur unter Raubbau an ihrer Gesundheit.
In den Versicherungsbedingungen wird jedoch nicht verlangt, dass der (bzw. die) Berufsunfähige seinen Beruf tatsächlich nicht mehr ausübt, sondern nur, dass die festgestellten Gesundheitsbeeinträchtigungen seiner Tätigkeit vernünftigerweise und im Rahmen des Zumutbaren nicht mehr gestatten, erklärte das OLG.
Gestützt auf die überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen waren sich die Richter sicher, dass die Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit einen derartigen Raubbau an der Gesundheit der Klägerin bedeutete und dass sie wegen gravierender beruflicher Beeinträchtigungen vernünftigerweise ihre berufliche Tätigkeit hätte einstellen müssen.
Der Sachverständige hat dazu für das Gericht überzeugend ausgeführt, dass eine erkrankte Person ihren Arbeitsalltag nach außen hin durchaus noch eine Zeit lang „durchhalten“ kann, ohne dass das Umfeld eine spürbare Beeinträchtigung wahrnimmt. Er hat sodann aber bekräftigt, dass ein solches „Durchhalten“ nach außen einen Raubbau an der Gesundheit der Klägerin darstellte, möge es auch für deren berufliches Umfeld so ausgesehen haben, als könne sie ihrer Tätigkeit uneingeschränkt nachgehen.
(Versicherungsrecht 69 (2018), 20: 1241–1243)
Berufsunfähiger Dachdeckergeselle kann auf den Beruf eines Rettungsassistenten verwiesen werden
Bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung kann (bei entsprechender Vertragsgestaltung) ein gelernter Dachdeckergeselle auf den Beruf eines Rettungsassistenten verwiesen werden, denn dieser ist mit seiner bisherigen Lebensstellung vergleichbar, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf mit Beschluss vom 22.10.2018 (AZ: I-24 U 4/18). Auch sind geringe Einkommensverluste und Abweichungen bei der Arbeitszeit und deren Verteilung im zumutbaren Umfang vom Versicherungsnehmer hinzunehmen.
Geklagt hatte ein Versicherungsnehmer, der nach den Kriterien der Berufsunfähigkeitsversicherung als Dachdeckergeselle berufsunfähig war und entsprechende Leistungen des Versicherers bezogen hatte. Diese Leistungen waren aber im Zuge einer Nachprüfung vom Berufsunfähigkeitsversicherer eingestellt worden, da der Versicherte inzwischen eine Tätigkeit als angestellter Rettungsassistent ausübte.
Hier war das (vorher zuständige) Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass der vom Kläger nun ausgeübte Beruf eines Rettungsassistenten der bisherigen Lebensstellung als Dachdeckergeselle entspricht, erklärte das OLG und schloss sich dieser Beurteilung an:
Eine Verweisung des Versicherungsnehmers auf eine andere Tätigkeit kommt nach den einschlägigen Versicherungsbedingungen nur dann in Betracht, wenn die andere Tätigkeit der bisherigen Lebensstellung des Versicherten entspricht, wobei die bisherige Lebensstellung vor allem durch die zuletzt ausgeübte Tätigkeit geprägt ist. Ihre Berücksichtigung sondert Tätigkeiten aus, deren Ausübung deutlich geringere Fähigkeiten und Erfahrung erfordert als der bisherige Beruf.
Die Lebensstellung des Versicherungsnehmers wird also von der Qualifikation seiner Erwerbstätigkeit bestimmt, die sich wiederum daran orientiert, welche Kenntnisse und Erfahrungen die ordnungsgemäße und sachgerechte Ausübung der Tätigkeit voraussetzt. Eine Vergleichstätigkeit ist dann gefunden, wenn die neue Erwerbstätigkeit keine deutlich geringeren Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und in ihrer Vergütung sowie in ihrer sozialen Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau des bislang ausgeübten Berufs absinkt.
Unstreitig erfordert eine Tätigkeit als Rettungsassistent jedoch keine geringeren Kenntnisse und Fähigkeiten als die eines Dachdeckergesellen, denn beide Berufe bedingen eine qualifizierte Ausbildung, so die Düsseldorfer Richter. Zu Recht habe das Landgericht weiter darauf hingewiesen, dass die soziale Wertschätzung eines Rettungsassistenten jedenfalls nicht unter der eines Dachdeckergesellen liegen dürfte.
Zutreffend sei das Landgericht weiter davon ausgegangen, dass das vom Kläger zuletzt als Dachdeckergeselle erzielte Gehalt der Vergleichsberechnung zugrunde zu legen sei und nicht die Vergütung eines Dachdeckerfachgesellen. Eine solche hat er zu keinem Zeitpunkt erzielt, da er zum Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit noch keine drei Jahre als Dachdecker tätig gewesen war. Der vom Kläger behauptete „Automatismus“ einer Bezahlung als Dachdeckerfachgeselle nach Ablauf von drei Jahren liegt nicht vor.
Es ist bei Berufsunfähigkeitsversicherungen auch allgemein üblich, auf den tatsächlich zuletzt ausgeübten Beruf (Hervorhebung durch das OLG) abzustellen und nicht auf einen fingierten Beruf. Denn allein die Berufsausübung vor Eintritt des Versicherungsfalls liefert die Vergleichsmaßstäbe dafür, ob die neue Tätigkeit der bisherigen Lebensstellung entspricht. Deshalb muss bekannt sein, wie sie konkret ausgestaltet war, welche Anforderungen sie an den Versicherungsnehmer stellte und welche Fähigkeiten sie voraussetzte.
Wenn es um die Leistungseinstellung wegen neu erworbener beruflicher Fähigkeiten geht, kommt es auf einen Vergleich der vor dem Anerkenntnis zuletzt ausgeübten mit der anderen Tätigkeit an, auf die der Versicherungsnehmer verwiesen werden soll. Das gilt auch bei der Nachprüfung des Fortbestehens der Berufsunfähigkeit.
Deshalb ist unter „Beruf“ lediglich die Erwerbstätigkeit des Versicherungsnehmers in eben der konkreten Ausgestaltung zu verstehen, durch die der Versicherte sein Einkommen bei Eintritt des Versicherungsfalls erzielt hat und die Grundlage seiner Lebensstellung bis dahin gewesen ist.
Zur Frage des Einkommens führten die Düsseldorfer Richter aus, dass bei einem Einkommensverlust von weniger als 10 % die Zumutbarkeitsgrenze in keinem Fall überschritten ist, so dass dies der Beurteilung einer Gleichwertigkeit der Lebensstellung nicht entgegensteht. Auch aus dem Umstand, dass der Kläger als Rettungsassistent nicht mehr regelmäßig die Wochenenden für seine Freizeitplanung einschalten kann, sondern seine freien Tage auch unter der Woche liegen können, folgt nicht Abweichendes.
Ebenso vermag die Tatsache, dass dem Kläger für seine sozialen Kontakte zur Familie und zu Freunden nicht mehr verlässlich die Wochenenden zur Verfügung stünden, keine Berücksichtigung finden bei der durch den Vergleich von Ausbildung, Einkommen und sozialem Ansehen geprägten Beurteilung. Im Übrigen ist auch der Beruf des Dachdeckers von wechselnden Arbeitszeiten und damit einhergehenden Änderungen der freien Zeit geprägt, was sich bereits aus dem Rahmentarifvertrag für das Dachdeckerhandwerk und der dort vorgesehenen Umverteilung der wöchentlichen Arbeitszeit (nach den betrieblichen Erfordernissen und den jahreszeitlichen Licht- und Witterungsbedingungen) ergibt.
Nach diesem Hinweisbeschluss des OLG hat der Kläger seine Berufung zurückgenommen, merkt die Redaktion an.
(Versicherungsrecht 69 (2018), 24: 1497–1498)
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden