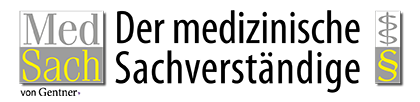Die Gutachtenerstellung begleitet die Medizin seit dem Altertum. Bereits in den frühen Hochkulturen in Ägypten und Mesopotamien wurden Ärzte für gutachterliche Fragen etwa bei Unfällen und damit zusammenhängenden Fragen der Entschädigung herangezogen. Als Medizin und Recht im 18. Und 19. Jahrhundert enger zusammenkamen und Sozial- und Privatversicherungen entstanden, setzte eine Professionalisierung der Tätigkeit des Gutachters ein. Mit den damit differenzierter und für den einzelnen bedeutender werdenden Fragen an die Gutachter sahen sich diese nun aber auch zunehmend den unterschiedlichen Erwartungshaltungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen ausgesetzt und mussten auch für sich selbst ihre Rolle im gesellschaftlichen System finden. Hierüber wird im ersten Beitrag dieser Ausgabe im Beitrag von Thomann referiert.
Auch gutachtlich ist die SARS-2-Covid Epidemie keinesfalls als aufgearbeitet anzusehen. Im folgenden Beitrag von Vossler-Thies, Molt, Schmidt, Hoheisel, Beck und Liske werden die Ergebnisse von ausführlichen neuropsychologischen Untersuchungen an 105 Patienten mit geklagten Langzeitfolgen nach SARS-2-Covid Infektion vorgestellt. Hingewiesen wird von ihnen besonders auf die Notwendigkeit einer Leistungsvalidierung der Ergebnisse zum Ausschluss nicht valider Untersuchungsergebnisse.
Der Beitrag von Schmidt und Schmidt greift die schwierige gutachtliche Frage der Beurteilung einer Schulterverletzung ohne nachweisbaren Substanzschaden auf und versucht mit einer Entscheidungshilfe hier zu einer nachvollziehbaren gutachtlichen Aussage zu kommen. Eine weitere Entscheidungshilfe bei Schulterverletzungen war von Seiten der SUVA in der Schweiz auch schon in der letzten Ausgabe 2/2025 von Koch et al. vorgestellt worden.
Der letzte Beitrag von Krause hat das in dieser Zeitschrift eher selten behandelte Thema der zahnärztlichen Begutachtung prothetischer Versorgungen zum Inhalt. Angesichts von etwa 100000 Begutachtungen hierzu im Jahr nach schon etwas älteren Zahlen des Medizinischen Dienstes dürfte aber die Bedeutung dieses Fachgebietes kaum zu unterschätzen sein.
Wie schon im Editorial der vorigen Ausgabe 2/2025 ausgeführt findet im Herbst dieses Jahres nicht wie seit 1988 gewohnt ein Heidelberger Gespräch statt. Neuer Termin nach Neuaufstellung der Tagung wird vermutliche der Anfang des Jahres 2026 sein, die interessierte Leserschaft wird nach der anstehenden Beiratstagung so schnell wie möglich informiert werden.
E. Losch, Frankfurt am Main