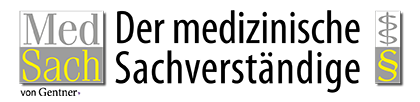Nahe Angehörige von traumatisierten Personen können Symptome entwickeln, die denen der Betroffenen stark ähneln: Sie leiden unter Ängsten und depressiven Beschwerden. Auch typische Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) können auftreten. Dazu gehören Schreckhaftigkeit oder das Vermeiden von Situationen, die das Erlebte wachrufen könnten. „Man spricht hier von einer sekundären Traumatisierung“, sagt Dr. phil. Rahel Bachem, Autorin des PID-Beitrags. „Sind die eigenen Kinder betroffen, handelt es sich um eine intergenerationale Traumatisierung“, so die klinische Psychologin, die derzeit am I-CORE Research Center for Mass Trauma an der Universität in Tel Aviv forscht.
Wie sehr die eigenen Kinder „mitleiden“, hängt Studien zufolge von der Stärke der elterlichen PTBS-Symptome ab sowie von der Art des Traumas. Besonders schwer wiegen von Menschen verursachte Traumata. „Die Erfahrung, dass Menschen zu Grausamkeit fähig sind – etwa zu Folter während einer Kriegsgefangenschaft – erschüttert das menschliche Grundvertrauen zutiefst“, sagt Bachem. Die Opfer hätten oft Schwierigkeiten, sich langfristig auf intime Beziehungen einzulassen. Das zeige sich dann auch in der Beziehung zu den eigenen Kindern, zu denen sie keine nahe und zärtliche Beziehung aufbauen könnten. Gleichzeitig zeigten Untersuchungen, dass die Furcht der Eltern vor neuen Situationen oder fremden Personen sich ebenfalls auf die Kinder überträgt. Das hindere die Kinder daran, altersgerechte Erfahrungen zu machen.
Bachem verweist dazu auf eine Studie mit Veteranen des Jom-Kippur-Kriegs 1973 gegen Israel: 40 Jahre nach dem Krieg bewerteten israelische Veteranen, die in Kriegsgefangenschaft waren, das Verhältnis zu ihren Kindern rückblickend als weniger nah als Veteranen, die nicht in Gefangenschaft geraten waren. Auch die – inzwischen erwachsenen – Kinder berichteten von stärkerer Kontrolle und geringerer väterlicher Zuwendung.
Die Jom-Kippur-Studie zeigte auch, dass die Übertragung der traumatischen Belastung nicht immer auf direktem Wege verlaufen muss. „So hatte die durch den Vater übertragene PTBS der Mutter einen größeren Einfluss auf die Kinder als die primäre PTBS des Vaters“, berichtet Bachem – vermutlich, weil in der Regel die Mutter die wichtigste Bezugsperson der Kinder war. Es sei daher wichtig, auch die Partner und Partnerinnen traumatisierter Elternteile psychosozial zu unterstützen und in ihrer Elternrolle zu stärken.
Um die Weitergabe von Traumata zu vermeiden, müsse zudem das Schweigen in der Familie durchbrochen werden. „Oft scheint eine unausgesprochene Abmachung zu gelten, nicht über das Trauma der Eltern zu sprechen“, sagt Bachem. Die Kinder empfinden dann zwar die psychische Belastung der Eltern, bekämen aber keine Erklärung. Solchermaßen im Ungewissen gelassen, hätten sie im späteren Leben eher zwischenmenschliche Schwierigkeiten und könnten emotionale Nähe schlechter zulassen. Darum solle mit den Ursachen des Traumas möglichst offen umgegangen werden – entsprechend der kognitiven Reife und den emotionalen Bedürfnissen des Kindes.
R. Bachem:
Intergenerationale Weitergabe von Traumata
PiD Psychotherapie im Dialog 2019; 20 (2); S. 42–45