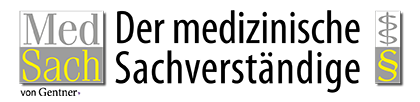Ein psychiatrisches Gutachten zur Feststellung der Berufsunfähigkeit genügt den Anforderungen nicht, wenn es lediglich auf ärztliche Zeugnisse Bezug nimmt, die allein die Angaben des Versicherungsnehmers referieren. Dem Gutachten muss sich in jedem Fall die eingehende Exploration des Patienten und eine kritische Überprüfung der Beschwerdeschilderung entnehmen lassen, so der erste Leitsatz eines Urteils des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden vom 5.11.2019 (AZ: 4 U 390/18), den die Fachzeitschrift „Versicherungsrecht“ mitteilt.
Die Klägerin, welche eine Tätigkeit als leitende Angestellte in einem zahnärztlichen Labor ausgeübt hatte, hatte Leistungen aus der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung begehrt, nachdem sie wegen einer rezidivierenden depressiven Störung sowie einer Panikstörung in einer Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie teilstationär behandelt worden war. Nachdem der Klage zunächst vom Landgericht stattgegeben worden war, hatte die Berufung der Versicherungsgesellschaft Erfolg und führte zur Klageabweisung durch das OLG.
Voraussetzung für Berufsunfähigkeit ist, dass „die versicherte Person infolge Krankheit ... mindestens 6 Monate ununterbrochen zu mindestens 50 % außerstande ist, ihren zuletzt vor Eintritt dieses Zustands ausgeübten Beruf nachzugehen“. Von dem Vorliegen dieser vertraglichen Voraussetzungen war jedoch nach dem Gutachten des vom OLG beauftragten Sachverständigen nicht mit der notwendigen Sicherheit auszugehen, so die Dresdener Richter.
Zwar hat der Sachverständige – wie die vorbehandelnden Ärzte und Vorgutachter – krankheitswertige psychische Beeinträchtigungen in Form einer Panikstörung, einer generalisierten Angststörung, einer depressiven Störung sowie einer somatoformen autonomen Funktionsstörung angenommen. Er kam jedoch im Ergebnis seiner Begutachtung zu dem Schluss, dass die von ihm festgestellten psychischen Störungen sich nicht soweit auf die psychische Leistungsfähigkeit der Klägerin auswirkten, dass diese dauerhaft weniger als die Hälfte ihres früheren Arbeitspensums als leitende Angestellte in einem Dentallabor bewältigen könnte.
Zur Begründung hat der Sachverständige in seinem Gutachten ausgeführt, dass er bei der Klägerin in Bezug auf die psychosozialen Kriterien einschl. der Organisation der Lebensführung keine quantitativen Leistungseinschränkungen feststellen konnte:
eine schwerer ausgeprägte Symptomatik bezüglich typisch depressiver Symptome zeigten, war diese – angesichts der klinisch-psychopathologischen Untersuchungsbefunde – auf bei der Klägerin bestehende Aggravationstendenzen zurückzuführen.
für die konkret von ihr angeführte Leitungsfunktion in einem Zahnlabor verfügt.
An dem vorherigen, erstinstanzlich angefertigten Gutachten – in dem das Vorliegen von Berufsunfähigkeit bestätigt worden war – übte das OLG deutliche Kritik: Hier seien „die Annahmen des ... Sachverständigen in sich widersprüchlich“ gewesen und die Begutachtung habe sich „auch methodisch als nicht in jeder Hinsicht überzeugend dargestellt, da eine intensive Exploration der Klägerin nicht erfolgt“ sei.
So lassen sich diesem Gutachten etwa keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Sachverständige die Angaben der Klägerin im Rahmen des zweistündigen Anamnesegesprächs auch in Bezug auf die referierten Vorbefunde kritisch hinterfragt oder hinreichend überprüft habe, ob die von ihm festgestellte Dysthymie sie tatsächlich gehindert habe, als maßgeblich bewertete Teiltätigkeiten auszuüben. Gegen die Annahme des Sachverständigen, die Klägerin habe ihre berufliche Tätigkeit nicht ausüben können, spreche bereits, dass der Gutachter selbst keine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen habe feststellen können. Auch habe der Sachverständige keine Testung zur Beschwerdevalidierung durchgeführt.
Schließlich sei auch eine Antriebsminderung, die für die Frage von Alltagseinschränkungen und für das Vorliegen einer chronifizierten schwergradigen Depression entscheidend sei, im Rahmen dieser Begutachtung gerade nicht nachweisbar gewesen. Es sei auch nicht ersichtlich, dass sich der Sachverständige insoweit ausreichend mit den Vorbefunden zweier vorbehandelnder Kliniken auseinandergesetzt hätte, in denen der Antrieb als „unauffällig“ bzw. regelrecht“ beschrieben worden sei.
(Versicherungsrecht 71 (2020) 17: 1124–1128)
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden