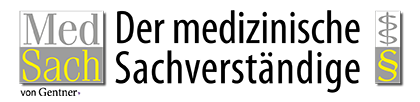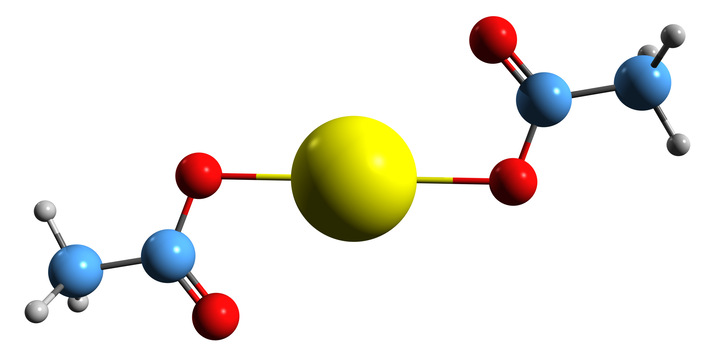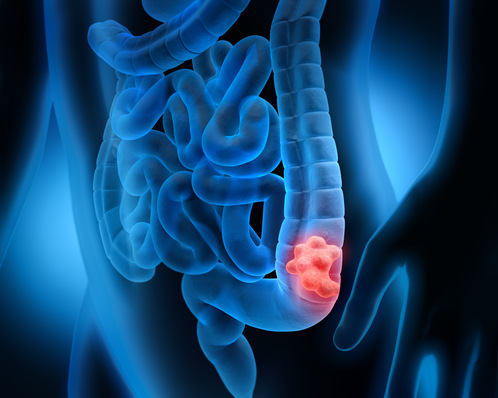Die Lebenszeitprävalenz depressiver Erkrankungen schwankt zwischen 16 % und 20 % und die 12-Monats-Prävalenz für unipolare Depressionen liegt bei knapp 8 %. Die 12-Monats-Prävalenz von Angststörungen liegt mit 14 % sogar noch höher; alleine in Europa leiden siebenmal mehr Menschen an einer Angststörung als an einem Schlaganfall und mehr als 100-mal so viel im Vergleich zu Multipler Sklerose.
Sowohl klinisch relevante Angst als auch depressive Symptome können kausal und zeitlich unabhängig von neurologischen Erkrankungen, in zeitlichem Zusammenhang als komorbide Störung (ggf. mit partieller Kausalität im Sinne von psychischen Adaptationsvorgängen) oder neurobiologisch vermittelt als Partialsymptom einer neurologischen Erkrankung auftreten.
Das gemeinsame Auftreten von Angst und Depressivität steigert – unabhängig vom klinischen Kontext – das Inanspruchnahme-Verhalten medizinischer Leistungen und verkompliziert den Krankheitsverlauf. Bei neurologischen Erkrankungen ist das komorbide Vorliegen von Angst- oder depressiven Störungen zudem generell mit einer schlechteren Lebensqualität assoziiert.
Negative Effekte sind dabei vor allem für Morbus Parkinson und Multiple Sklerose sowie auch für Epilepsie, Migräne und in der Folge von Schlaganfällen beschrieben. Insbesondere nach Schlaganfällen stellt die bei einem Drittel der Betroffenen auftretende Apathie, die eine große Nähe zur Depressivität hat, eine besondere Herausforderung dar, so Lahmann.
Generell gelte die Empfehlung, bei Hinweis auf Beschwerden aus einer der drei Beschwerdecluster Angst, depressive Symptome und funktionelle neurologische Beschwerden aufgrund der hohen Überschneidungen aktiv immer auch nach Beschwerden im Bereich der jeweils anderen zwei Cluster zu fragen.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden