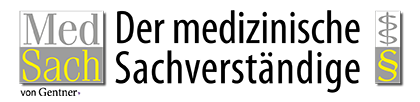Das traditionelle Männerbild ist geprägt von Eigenständigkeit, Stärke und zurückhaltenden Gefühlsäußerungen. Männer, die diesem Vorbild folgen, können typische Symptome einer depressiven Störung wie Erschöpfung und Traurigkeit schwer zulassen. "Stattdessen werden atypische oder für diese Männer 'akzeptable' depressive Symptome wie Wut, Aggression, Substanzgebrauch, Risikobereitschaft oder Reizbarkeit gezeigt", erläutern Walther und Seidler in ihrem Beitrag. Wenn traditionelle und alternative Symptome der Depression zur Diagnose kombiniert würden, löse sich der Geschlechterunterschied bezüglich der Erkrankungshäufigkeit auf, wie eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe in den USA gezeigt habe, so die beiden klinischen Psychologen.
Untersuchungen depressiver Männer und Frauen haben gezeigt, dass auch Männer unter traditionellen Symptomen, wie depressiver Stimmung, Erschöpfung oder Schlafstörungen litten, aber signifikant häufiger über Reizbarkeit, Wut und Drogenmissbrauch berichteten als Frauen. Bei Patientinnen indes stehen Traurigkeit, Erschöpfung oder Schlafstörungen im Vordergrund.
"Nur Schwächlinge gehen zu Seelenklempnern"
Das Rollenbild hat aber nicht nur Einfluss auf die Ausprägung und Wahrnehmung der Symptome, sondern auch auf die Bereitschaft therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. "In Deutschland suchen Männer zu 30 Prozent weniger psychiatrische und psychotherapeutische Dienstleistungen auf als Frauen. Noch größer ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen mit einer diagnostizierten Depression. Unter ihnen beginnen Männer nur halb so oft eine Psychotherapie wie Frauen." Je mehr sie mit traditionellen Rollenbildern konform gehen, desto höher ist das Maß an Selbststigmatisierung, aus der letztlich schädliche Überzeugungen erwachsen wie "Nur Frauen und Schwächlinge gehen zu Seelenklempnern." Entscheiden sich Männer schließlich doch für eine Therapie, beginnt diese oft erst in späteren Phasen des Krankheitsverlaufs. Daher könnten sie ein höheres Risiko für eine Chronifizierung und schlechtere Behandlungsergebnisse haben, so die Autoren. Die Studienlage sei hier jedoch nicht eindeutig.
Es sei wichtig, mehr Männer als bisher zu einer Behandlung zu bewegen und ihnen männerspezifische Angebote zu machen. Mit den bisherigen Ansätzen ließen sich Männer nur schwer erreichen, wie Untersuchungen zeigten: "Über 60 Prozent der Männer, die Suizid begehen, waren im vorangehenden Jahr in Kontakt mit einer Institution für psychische Gesundheit. Darüber hinaus berichten über die Hälfte der Männer, die eine psychotherapeutische Behandlung wegen Depression erhielten, über ein Gefühl der Gleichgültigkeit oder Unzufriedenheit mit der erhaltenen Therapie", berichten Walther und Seidler.
Männerspezifische Psychotherapie
Beide entwickeln derzeit in verschiedenen Projekten Ansätze für eine spezifische Psychotherapie für Männer mit depressiven Störungen. Hier haben sie Faktoren identifiziert, die für eine gute Behandlung wichtig sind. So kann die Selbstoffenbarung des Therapeuten einen positiven Effekt auf den Therapieverlauf haben. Geben Therapeuten bewusst ausgewählte Informationen von sich preis, haben die Betroffenen weniger das Gefühl, sich durch die Schilderung eigener Erfahrungen ‚auszuliefern‘. So kann dem Patienten ein Stück Kontrolle zurückgegeben werden. Zudem erhöht eine männerorientierte Sprache die Akzeptanz seitens des Patienten. „Nur durch eine systematische Auseinandersetzung mit männlichen Geschlechterrollen und ihren Auswirkungen auf die Symptompräsentation und den Therapieprozess bei depressiven Störungen, ist eine erfolgreiche Behandlung möglich“, sind die Experten überzeugt.
Autoren
Dr. phil. Andreas Walther ist Oberassistent für Wissenschaft und Lehre an der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Zürich und fallführender klinischer Psychotherapeut am Ambulatorium für Kognitive Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin des psychotherapeutischen Zentrums der Universität Zürich. Mitglied der Task Force on Men’s Mental Health der World Federation of Societies of Biological Psychiatry.
Dr. phil. Zac E Seidler ist Klinischer Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Orygen (National Centre of Excellence in Youth Mental Health) an der Universität von Melbourne und Director of Health Professional Training at global men‘s health charity, Movember.
A. Walther und Z. E. Seidler:
Männliche Formen der Depression und deren Behandlung
PiD Psychotherapie im Dialog 2020; 21 (4); S. 1–6
Was steckt hinter dem "Movember"?
Der "Movember" wurde 2003 von einer Gruppe junger Männer in Adelaide initiiert. Der Begriff setzt sich aus den Begriffen moustache (Schnurrbart) und November zusammen. Seit 2004 beziehungsweise 2006 gibt es in Australien und Neuseeland jährliche "Movember"-Veranstaltungen, deren Ziel es ist, Aufmerksamkeit auf die Gesundheit von Männern zu lenken. Primär geht es um die Vorbeugung und bessere Behandlung von Prostata- und Hodenkrebs. Doch auch die Erforschung von Depression wird gefördert. Sie ist bei Männern weit verbreitet, jedoch unterdiagnostiziert. Dafür werden Spenden gesammelt, die über nationale Organisationen der Forschung zugutekommen. In Deutschland wird die Aktion offiziell seit 2012 durchgeführt.
Pressemitteilung thieme.de